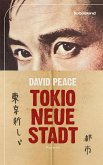Ein dunkles Geheimnis schweißt sie zusammen - Enkel und Großvater sind unzertrennlich. Doch dann stirbt der Großvater. Der Enkel reist in dessen Vergangenheit und findet nördlich des Polarkreises eine grausame Wahrheit. Im stalinistischen Russland war der Großvater Kommandant eines Gefangenenlagers. Wie konnte er all die Jahre mit dieser Last auf seinen Schultern leben? Rettete ihn seine tiefe Liebe zum Enkel? In einer kraftvoll poetischen Sprache erzählt Lededew von Russlands Hölle, einem Ort, an dem das Leben endet und das Sterben ewig weitergeht.
Die neue Stimme aus Russland - dieser packende Roman brennt sich tief in die Seele ein.
Die neue Stimme aus Russland - dieser packende Roman brennt sich tief in die Seele ein.

Sergej Lebedew kämpft gegen Geschichtsvergessenheit
Im hohen Norden und Fernen Osten Russlands stoßen Geologen und Hobby-Archäologen immer wieder auf grausame Zeugnisse der jüngsten Geschichte. In den Böden des Permafrostes wollen die Leichen der einstigen GULag-Sträflinge und Zwangsdeportierten einfach nicht verwesen, als wollten sich die Opfer damit ein Denkmal ertrotzen, das ihnen der russische Staat bis heute verwehrt. Längst ist Stalin wieder salonfähig, und mancherorts stehen sogar neue Denkmäler, wie zum Beispiel im nordossetischen Digora, seitdem bekanntwurde, dass der Diktator möglicherweise zur Hälfte Ossete gewesen ist.
In der Euphorie der Perestrojka, meint der 1981 in Moskau geborene Schriftsteller Sergej Lebedew, hätten seine Landsleute naiv geglaubt, man müsse die Wahrheit über den GULag und die anderen Verbrechen der Stalinzeit nur herausschreien, und die dunkle Vergangenheit sei vergangen. Lebedew ist derzeit Stipendiat am Literarischen Colloquium Berlin und redet sich bei einem Spaziergang am Wannsee regelrecht in Rage, was so gar nicht zu seinem jungenhaften, zurückhaltenden Äußeren passt. In diesem Frühjahr ist sein Romandebüt "Der Himmel auf ihren Schultern" auf Deutsch erschienen (bei S. Fischer). Anders als die großen Stenographen des GULag, Alexander Solschenizyn und Warlam Schalamow, rekonstruiert Lebedew in seinem Roman nicht so sehr das Martyrium der Opfer, sondern das Psychogramm eines Täters. Das ist neu in der zeitgenössischen Literatur Russlands, genauso wie das Interesse an diesem Thema für einen Autor seiner Generation.
Dass zur Gerechtigkeit auch Institutionen gehören, hätten die Russen damals nicht bedacht, sagt Lebedew. Bis heute gelten die Millionen Opfer als bedauerlicher Kollateralschaden auf dem Weg in die Moderne und beim Aufstieg zur Weltmacht. Lebedews Eltern, beide Geologen, haben ihm erzählt, dass sie in Jakutien im Sommer Bären beobachtet haben, die immer wieder aus der Taiga an einen Futternapf der besonderen Art kamen, zu einem Massengrab. Im ökonomischen Chaos der neunziger Jahre verdiente er als Jugendlicher Geld damit, in den geschlossenen sowjetischen Minen nach Bergkristallen und seltenen Mineralien zu suchen, die für gutes Geld in den Westen verscherbelt wurden. Dabei sei er auf die traurigen Reste der Lager gestoßen und habe begriffen, dass man die Geschichten erzählen muss, solange sich die Natur die Orte nicht ganz zurückgeholt hat.
Später hat Lebedew als Reporter das verrottende Erbe der Sowjetunion überall im Land bereist: triste Industriestädte, die aus den Lagern und somit buchstäblich auf den Knochen der Häftlinge entstanden waren, oder ein verlassenes gigantisches Pionierlager in Kasachstan, wo die verrosteten Löffel noch auf den Tischen lagen. Den letzten Anstoß für sein Buch gab schließlich eine Geschichte aus der eigenen Familie. Lange nach dem Tod seines Stiefgroßvaters (der leibliche war im Krieg gefallen) musste der junge Mann feststellen, dass dessen zahlreiche Orden nicht aus dem "Großen Vaterländischen Krieg" stammten, sondern ihm vom NKWD für besondere Verdienste im Umgang mit Staatsfeinden verliehen worden waren.
Die Geschichte des Romans beginnt in einer idyllischen Datschensiedlung bei Moskau, wo die Familie beim Erwerb eines Sommerhauses auch die Fürsorge für einen blinden Nachbarn mit auferlegt bekam. Zwischen diesem alten Mann und einem quasi von ihm als Enkel angesehenen Jungen, dem Ich-Erzähler, entstand eine eigenartige Verbindung - seitens des Alten zwischen Liebe und Herrschsucht schwankend, seitens des Jungen zwischen Angst und Bewunderung. Der Blinde, stets distanziert "zweiter Großvater" genannt, spendete gegen den Rat seiner Ärzte Blut, um den Jungen nach einem Hundebiss zu heilen. Als sich sein eigener Gesundheitszustand verschlechterte, konnte der einstige Staatsbeamte nicht nach Moskau zur professionellen Versorgung gebracht werden, weil auf den abgesperrten Straßen gerade die Panzer dem Weißen Haus entgegenrollten. Das sowjetische Imperium war Geschichte.
Jahre später findet der Erzähler in der ihm vererbten Wohnung des Großvaters Briefe und Indizien, die auf mysteriöse Leerstellen in dessen Biographie verweisen. Wie Erdflöze trägt er nun die Vergangenheit in Schichten ab, wobei immer neue Hohlräume, die man im Bergbau "Alte Männer" nennt, entstehen. Der zweite Großvater hatte als Lagerkommandant nicht nur Tausende von Menschen gequält, sondern viele auch in den sicheren Tod geschickt, indem er sie auf unbewohnten Inseln in der Tundra aussetzen ließ, wo ein Überleben unmöglich war. Er hatte auch seinen einzigen Sohn und seine Frau auf dem Gewissen.
Am Ende begibt sich der Erzähler auf die Spuren der Deportierten in die Weiten des Nordens und stürzt auf einer Insel in eine Erdhöhle voller unverwester Leichen. Es sind symbolisch aufgeladene, kathartische Bilder des Grauens, deren sprachliche Schönheit kaum zu ertragen ist. Überhaupt schwelgt der Roman in einer poetischen Sprache, die Übersetzerin Franziska Zwerg hatte ganze Arbeit zu leisten.
Als das Buch vor zwei Jahren in Russland herauskam, hätten sich viele junge Leute an ihn gewandt, sagt Lebedew, als wir vor dem Haus der Wannsee-Konferenz stehen. Sie alle hätten ähnliche Erfahrungen mit dem unheilvollen Schweigen in ihren Familien gemacht. Dass sich die Russen so schwer mit der Verantwortung für und der Erinnerung an die Verbrechen tun, hängt für ihn damit zusammen, dass diese Greuel für die meisten irgendwo weit weg im geographischen Niemandsland geschahen. Zwar gebe es von Aktivisten organisierte Gedenkstätten, doch wer fährt Tausende von Kilometern an die Kolyma oder nach Workuta, um sich die Überreste eines Lagers anzusehen?
In der Tristesse einer im Buch beschriebenen Industriestadt auf der Halbinsel Kola haben sich die einstigen NKWD-Schergen und deren Nachkommen mit den Angehörigen der Opfer in einer unheiligen Allianz aus Apathie, Korruption und Alkoholismus eingerichtet. Die Beseitigung der Folgen der unheilvollen industriellen und sozialen Utopien des Stalinismus sei, so der junge Autor, eine Aufgabe von menschheitlicher Dimension, der sich das heutige Russland aber nicht stelle. Im Gegenteil: Das riesige Land existiere nur noch geographisch, nicht historisch. Die staatlich sanktionierte Amnesie führe dazu, dass die Menschen nicht wissen, woher sie kommen, und wer seine Vergangenheit nicht kennt, sei blind für die Zukunft.
Lebedews neues, gerade beendetes Buch wird sich mit einer anderen Facette des Vergessens befassen, dem nie hinterfragten Verschwinden von Angehörigen. Täter und Opfer gibt es wie in seiner Familie, die auch hier als Vorlage diente, überall in der ehemaligen Sowjetunion. Irgendwann habe er Fotos bei seiner Großmutter gefunden und nicht gewusst, wer all die Menschen darauf waren. Zum Glück habe die Großmutter vor ihrem Tod noch alles aufgeschrieben, und so weiß der Schriftsteller jetzt, dass der Familienname früher nicht Lebedew, sondern Schwan gelautet hat. Lange vor der Revolution hatte es einen Arzt dieses Namens gegeben, der aus Leipzig nach Russland eingewandert war. Nächste Woche will er die fernen Verwandten in Deutschland zum erstmals besuchen.
SABINE BERKING
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Zutiefst beeindruckt hat Ulrich Rüdenauer das neue, von Franziska Zwerg herausragend übersetzte Buch des russischen Schriftstellers und Geologen Sergej Lebedew gelesen. In "Der Himmel auf ihren Schultern" folgt der Rezensent einem jungen Mann, der sich, nachdem sein Großvater nach einer Blutspende für ihn verstorben ist, auf die Spuren des alten Mannes begibt und erkennen muss, dass sein Lebensretter Lagerkommandant im Gulag gewesen ist. In apokalyptischen und "expressiven" Sprachbildern erlebt der Rezensent in den überwucherten Überresten der sowjetischen Straflager das einstige Grauen, das sich hier noch in verwesten und erfrorenen Leichenbergen offenbart. Dankbar ist Rüdenauer insbesondere für Lebedews mutiges Unternehmen, die fast verdrängte Geschichte des stalinistischen Terrors wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und so verzeiht er dem Autor gern die bisweilen allzu pathetische, "metapherntrunkene" Sprache und empfiehlt diesen aufrüttelnden Roman ohne Einschränkungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Lebedew wählt einen poetischen, zuweilen etwas metapherntrunkenen Weg - aber einen durchaus überzeugenden. Ulrich Rüdenauer Süddeutsche Zeitung 20130907