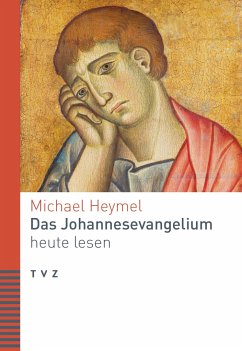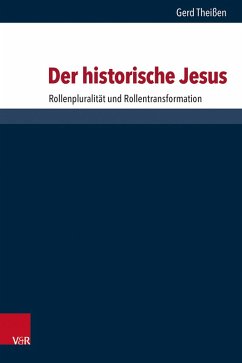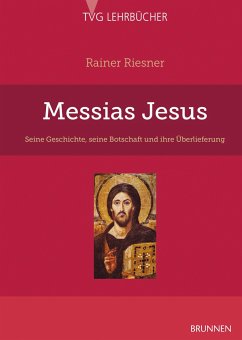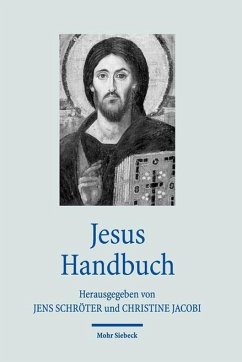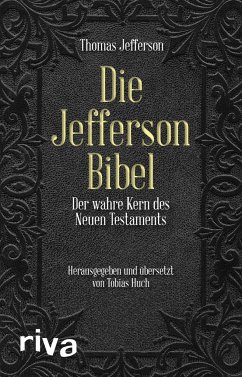Der historische Jesus
Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung
Herausgegeben: Schröter, Jens; Brucker, Ralph
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
179,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
This volume presents a collection of papers by scholars from Europe and the USA on a question which is currently again the subject of intensive discussion - the figure of the historical Jesus. One main problem is that of methodology - how in general can history be constructed from texts, how is it possible in this particular case to draw a picture of Jesus the person from the texts about him? This question is placed within the wider context of epistemological and historiographical enquiry. A further major question is that of the relationship between Jesus' work and the development of the Christian faith. Whereas earlier scholars often saw a gap between the two, many of the present contributors put forward a different point of view. In addition, a number of questions of detail are treated which are important for research into the historical Jesus (the law, Jesus' concept of death, judgement and salvation).
Der Band vereinigt Beiträge von Forschern aus Europa und den USA zur gegenwärtig wieder intensiv diskutierten Frage nach dem historischen Jesus ("Third Quest"). Ein Schwerpunkt ist die methodische Problematik: Wie kann - allgemein - aus Texten Geschichte konstruiert werden, wie ist es - speziell - möglich, aus den Zeugnissen über Jesus ein Bild seiner Person zu zeichnen? Diese Frage wird in den breiteren Rahmen erkenntnis- und geschichtstheoretischer Erwägungen eingeordnet. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Frage nach dem Verhältnis vom Wirken Jesu und der Entstehung des christlichen Glaubens. Wurde in der älteren Forschung des öfteren eine Diastase gesehen, so wird hier in etlichen der Beiträge eine andere Sicht entwickelt. Darüber hinaus werden für die historische Jesusforschung wichtige Einzelfragen (Gesetz, Todesverständnis Jesu, Gericht und Heil) behandelt.