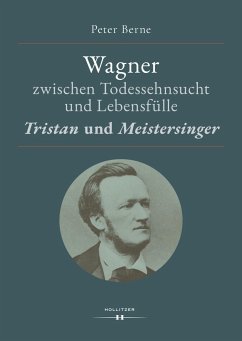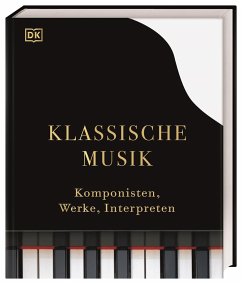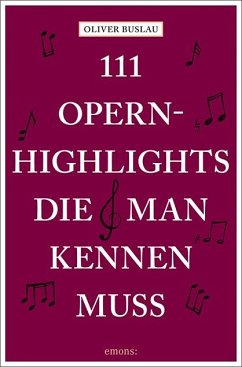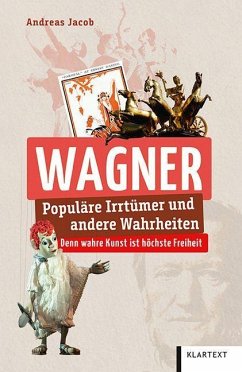Der Klang von Paris
Eine Reise in die musikalische Metropole des 19. Jahrhunderts

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Berlioz, Rossini, Meyerbeer, Wagner, Chopin, Offenbach, Pauline Viardot - diese und viele andere Künstler leben, lieben, leiden in der musikalischen Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und schreiben mit an der Partitur einer Metropole zwischen Revolution und Elektrizität, Eisenbahn und Kaiserreich.Erstmals wird Paris in diesem Buch als Zentrum europäischer Musik im 19. Jahrhundert erkundet, zugleich die Musik auf ihre Umgebung bezogen. Den Aufbruch in die Moderne, der sich hier in beispiellosem Tempo vollzieht, von Napoleons Tod bis zum Zweiten Kaiserreich, erleben wir hautnah, wenn Rossini sic...
Berlioz, Rossini, Meyerbeer, Wagner, Chopin, Offenbach, Pauline Viardot - diese und viele andere Künstler leben, lieben, leiden in der musikalischen Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und schreiben mit an der Partitur einer Metropole zwischen Revolution und Elektrizität, Eisenbahn und Kaiserreich.
Erstmals wird Paris in diesem Buch als Zentrum europäischer Musik im 19. Jahrhundert erkundet, zugleich die Musik auf ihre Umgebung bezogen. Den Aufbruch in die Moderne, der sich hier in beispiellosem Tempo vollzieht, von Napoleons Tod bis zum Zweiten Kaiserreich, erleben wir hautnah, wenn Rossini sich fotografieren lässt, Berlioz die Miete nicht zahlen kann, Meyerbeer Hollywood vorwegnimmt und Chopin im Zug fährt, wenn Balzac, Flaubert, Baudelaire die Oper besuchen und Offenbach die Zensur austrickst.
Soziales Elend und teure Soiréen, Alltag und Umbruch, Liebe und Kunst bringt dieses Panorama zusammen; Spurensuchen in der Gegenwart verbinden uns mit dem Vormittag unserer Epoche. Ihm kommen wir in der Musik so nah wie sonst nirgends: im Klang von Paris.
Erstmals wird Paris in diesem Buch als Zentrum europäischer Musik im 19. Jahrhundert erkundet, zugleich die Musik auf ihre Umgebung bezogen. Den Aufbruch in die Moderne, der sich hier in beispiellosem Tempo vollzieht, von Napoleons Tod bis zum Zweiten Kaiserreich, erleben wir hautnah, wenn Rossini sich fotografieren lässt, Berlioz die Miete nicht zahlen kann, Meyerbeer Hollywood vorwegnimmt und Chopin im Zug fährt, wenn Balzac, Flaubert, Baudelaire die Oper besuchen und Offenbach die Zensur austrickst.
Soziales Elend und teure Soiréen, Alltag und Umbruch, Liebe und Kunst bringt dieses Panorama zusammen; Spurensuchen in der Gegenwart verbinden uns mit dem Vormittag unserer Epoche. Ihm kommen wir in der Musik so nah wie sonst nirgends: im Klang von Paris.