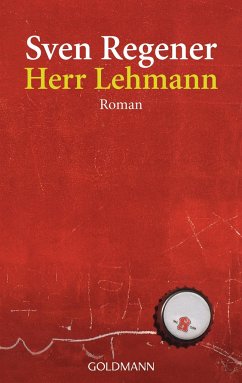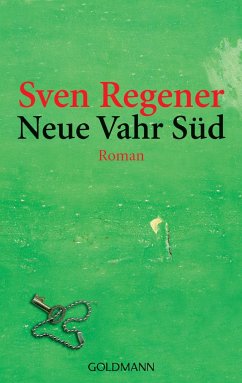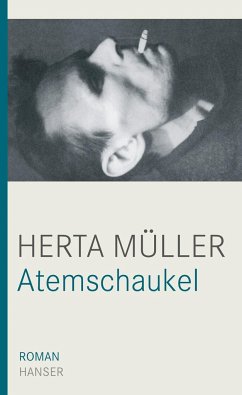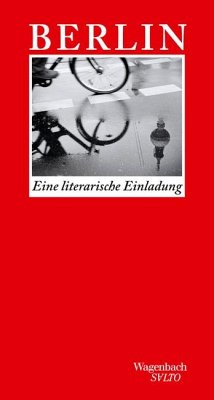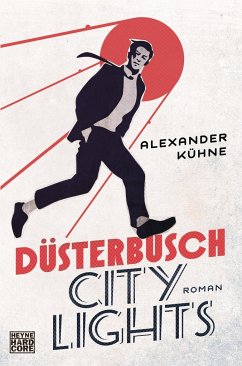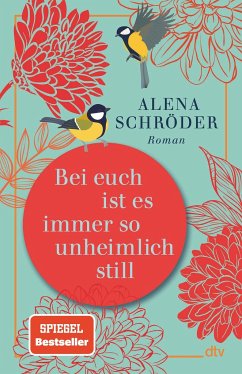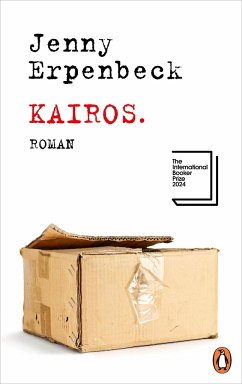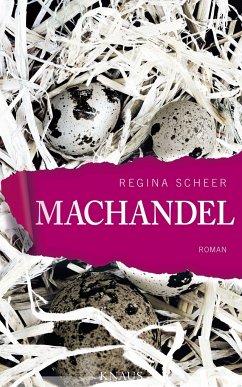Der kleine Bruder / Frank Lehmann Trilogie Bd.3
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
19,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Berlin-Kreuzberg, November 1980: Im Schatten der Mauer gedeiht ein Paralleluniversum voller Künstler, Hausbesetzer, Kneipenbesitzer, Kneipenbesucher, Hunde und Punks. Bier, Standpunkte, Reden, Verräterschweine - alles ist da. Nur eins fehlt: jemand, der alles mal richtig durchdenkt - Frank Lehmann aus Bremen. Nachdem seine WG dort vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, das Zimmer bei seinen Eltern zum Fernseherreparieren benötigt wird und er nach kühnem Ausbruch aus dem Wehrdienst noch keinen Plan hat, fährt er erst mal nach Berlin - zu seinem großen Bruder Manni, der dort als Künstler l...
Berlin-Kreuzberg, November 1980: Im Schatten der Mauer gedeiht ein Paralleluniversum voller Künstler, Hausbesetzer, Kneipenbesitzer, Kneipenbesucher, Hunde und Punks. Bier, Standpunkte, Reden, Verräterschweine - alles ist da. Nur eins fehlt: jemand, der alles mal richtig durchdenkt - Frank Lehmann aus Bremen. Nachdem seine WG dort vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, das Zimmer bei seinen Eltern zum Fernseherreparieren benötigt wird und er nach kühnem Ausbruch aus dem Wehrdienst noch keinen Plan hat, fährt er erst mal nach Berlin - zu seinem großen Bruder Manni, der dort als Künstler lebt und eine große Nummer ist. Dachte er. Doch Manni ist weg. Weder sein Vermieter Erwin Kächele noch dessen Nichte Chrissie oder sein Mitbewohner Karl haben eine Ahnung, wo Manni steckt. Außerdem nennen sie ihn nicht Manni, sondern Freddie. Und haben sofort eine konkrete Idee davon, was Frank zu tun hat: Anstelle seines Bruders an einem kurzfristig anberaumten Krisenplenum teilnehmen. Damit beginnt eine lange Nacht, in der Frank Lehmann lernt, dass in einer Welt, in der alle Künstler sein wollen, nichts notwendigerweise das ist, als das es erscheint, und in der er mehr über seinen Bruder erfährt, als er wissen will, aber nie das, wonach er fragt. Und mit einer Nacht ist es nicht getan, denn wie sagt Karl, der Typ, den Frank auf Anhieb nicht mag und der sein bester Freund werden wird: "Das ist wie in der Geisterbahn. Jetzt sind alle eingestiegen, und der Bügel geht runter, und dann müssen das auch alle bis zu Ende mitmachen ..."
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote