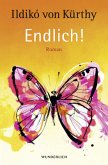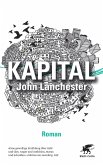Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
"Suter lesen ist wie eine gute amerikanische Fernsehserie sehen," brummt Andreas Fanizadeh voller Zufriedenheit. Nicht nur, dass er hier höchst plastisch und kulinarisch das Gebiet der Molekularküche ausgebreitet fand. Auch die in den "global verdichteten" Straßen von Zürich angesiedelte Geschichte rund um einen gefeuerten sri-lankischen Hilfskoch und eine lesbische Schweizer Kellnerin fand er niveauvoll unterhaltsam. Thematisch ordnet Fanizadeh den Roman als Verwebung der Schweiz in einen "kulinarisch-libidinösen" und "kriegerisch-industriellen Weltkomplex" ein. Hier und da hat er Kleinigkeiten zu bemängeln, etwa Suters Neigung zur Überspitzung seiner Schweizer Charaktere und seine Großzügigkeit dem sri-lankischen Protagonisten gegenüber, wo er es "gutmenschlich rumpeln" hört. Einmal gar lässt der Kritiker das Wort "kitschig" fallen. Insgesamt aber ist er des Lobes voll. Auch wegen der Rezepte im Anhang.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Männer, die kochen, Frauen, die mit Frauen schlafen, und moralisch ein Roman gewordener Grünen-Parteitag: "Der Koch" von Martin Suter ist ein Bestseller. Und trotzdem super
Schon wieder Suter gelesen. Warum eigentlich? Ich lese doch sonst nichts von so weit oben in der Bestsellerliste. Hat mich ja auch gar nicht nötig. So viele Bücher liegen hier rum, die im Grunde viel dringlicher mal gelesen, vielleicht sogar verstanden, bedacht und gelobt werden sollten; dicke Bücher mit langen Sätzen, komplexem Inhalt, unbequemen Neuigkeiten . . .
Aber: erst mal Suter. Schlanke Bücher. Kurze Sätze. Schauplatz immer irgendwie Zürich. Und ein Plot wie eine Schweizer Autobahn: Reich an Wendungen, aber so richtig schockierend unvorhergesehen kommt da nichts. Und trotzdem und trotzdem und trotzdem - oder gerade deswegen: Wieder mal weggelesen, in einem Zug. Und das bei einem Buch mit einem Titel, den es sich mit den Johannes Lafers und Horst Lichters dieser Welt teilen muss: "Der Koch".
Tatsächlich bestehen die Zutaten zu diesem Roman exakt aus dem Fernsehprogramm des letzten Jahres: Köche, Krise, Krieg, und am Ende kommt sogar noch die Schweinegrippe unter. Einen aktuelleren, zeitgenössischeren Roman gibt es derzeit im Buchhandel nicht; und dabei keinen so angenehm altmodischen: Martin Suter hat allen Ernstes Rezepte abdrucken lassen. Aphrodisierende Rezepte. Essen zum Flachlegen. Das ist natürlich in erster Linie eine herzerwärmende Hommage an Simmel, als dessen Wiedergänger Suter neuerdings dauernd bezeichnet wird - was die Auflagenhöhen beschreiben soll und den Mut zum Moralisieren. Was dagegen den Stil betrifft, ist Suter allerdings, wenn überhaupt, ein Simmel ohne Stuck - und in seinen soziologischen Beobachtungen näher an Georg Simmel als an Johannes Mario. Aber wenn sich die Rezepte, die Simmel (jetzt wieder J. M.) damals in "Es muss nicht immer Kaviar sein" zwischen die Handlung gestreut hatte, heute so avanciert lesen wie die Speisekarte in einem Brandenburgischen Dorfgasthof: dann gibt es diesen demokratisierenden Trickle-Down-Effekt ähnlich auch bei Suter. Bei ihm ist es, etwas ins Ayurvedische gewendet, die Mode der Molekularküche, der Toast Hawaii der nuller Jahre. Er beschreibt ein typisches Kulturgut unserer Zeit im Moment des Sinkens, also in dem Moment, in dem es gesichert als Allgemeingut angesehen werden kann.
Das war aber immer schon das Tolle und das Souveräne an Suter: dass sich alle Milieus gewissermaßen gegenseitig von oben her auf die Teller schauen können. Das war so in seinen schönen Kolumnen über den unsicheren Adabei Geri Weibel und seine Auskenner-Clique aus der "SchampBar", in der man eben selber kein Auskenner sein musste, um Bescheid zu wissen - und das ist hier so, wo ein sogenannter Edelgastronom im Bemühen, am Ball zu bleiben, die Cloches abschafft und das Molekularzeug einführt, was, als Entkopplung von Versprechen und Substanz, ja sehr gut zu einer Klientel von Finanzspekulanten und windigen Geschäftsleuten passt:
",Der Kunde sagt, welchen Prozentsatz er konservativ anlegen will und welchen etwas dynamischer.'
,Dynamischer!', stieß Dalmann aus, und dabei wurde ein winziges Stückchen Wachtelmousse auf den Teller seines Beraters katapultiert.
Keller blickte mit versteinerter Miene auf seine erst halb aufgegessene Vorspeise und legte Messer und Gabel parallel auf den Teller. Dalmann hatte seinen leer und legte das Besteck ebenfalls ab. ,Reden wir also von den Konservativen. UBS, zum Beispiel.'
,Das waren Blue Chips. Kein Mensch . . .'
Dalmann unterbrach ihn: ,Gehen sie runter? Gehen sie rauf?'
,Langfristig rauf.'
,Langfristig bin ich tot.'"
Der Dalmann: verfressen, eklig, geil und gefährlich. Und, was das "langfristig" betrifft, nun ja: im Irrtum. Denn da ist auch Küchenhilfe Maravan, Flüchtling, Tamile, Kochkünstler, der weiß, welche Speisen die Lust bringen - und welche den Tod; zunächst aber dermaßen lieb und gut und Ausländer und Rousseausches Idealgegenbild zur moralisch verkommenen Schweiz, dass man ihn beim Lesen manchmal direkt ein bisschen schütteln möchte. Dies tut dann die attraktive Kellnerin Andrea, die aber lieber mit Frauen schläft. Der Böse dick, alt und hässlich. Der Gute jung, schön und, wie gesagt, gut. Die Frau zwar lesbisch, aber doch auch für Männer attraktiv . . .
Wie nennt man so etwas? Holzschnittartig? Unbedingt! Immerhin gilt: Holzschnitte sind eine große und überaus schwierige Kunst, sie erfordern Planung, Präzision, Genauigkeit, die Kalkulation von Kontrasten. Und Martin Suter macht, so gesehen, vielleicht die besten und filigransten Holzschnitte seit Holbeins Baseler Totentänzen.
Man merkt jedem einzelnen Satz an, dass daran herumgeschnitzt wurde, bis wirklich nur noch das Nötigste dastand. Suter hat das uns gegenüber einmal als eine Arbeit des ständigen Wegnehmens und Filtrierens beschrieben (F.A.S. vom 27. August 2006); und dazu gehört auch, dass er seine Schweizer Heimatromane grundsätzlich fern der Heimat schreibt, in Guatemala oder auf Ibiza, aus einer Ferne, die alles wegblendet, was nicht zum Wesentlichen und Typischen gehört. Tatsächlich ist es vermutlich so, dass genau da der Reiz liegt: in der Fabulierunlust, der Knappheit, der Ökonomie. Man schaut auf diese Sätze wie auf ein wohlgeordnetes Dorf. Alles ist an seinem Platz, ist zweckmäßig und auf eine stille Art auch schön. Es herrscht nirgendwo Verschwendung, aber auch an keiner Stelle wirklich Mangel. Klar könnten die Figuren ein paar Brüche mehr haben, aber die, die sie haben, reichen eigentlich für die Geschichte.
Man kann das, was dann übrigbleibt, den Wesenskern nennen - oder Klischees, was allerdings nur ein weiterer Begriff aus der Drucktechnik wäre und im Ursprung ja nichts anderes meint als die Zuspitzung von Wahrheiten zum Zweck ihrer massenhaften Reproduktion.
Womöglich wäre das alles gleich viel hochliteraturiger, wenn der tamilische Flüchtling Frauen schlüge und der Schweizer Waffenschieber irre sympathisch und in der Aidshilfe engagiert wäre. Aber wahrer wäre es vermutlich nicht. Denn dass Asylanten durch fremde Sprache und Kultur zu einem Dasein in freundlicher Ironieferne verdammt sind, dass Geld, Gier und Skrupellosigkeit am häufigsten hinter den blassblauen Augen weißer übergewichtiger Männer wohnen, dass es im deutschsprachigen Raum Menschen gibt, die ihr Schlafzimmer tatsächlich "Master Bedroom" nennen und das auch so meinen: das alles sollte ja eigentlich immer noch eher gegen die Verhältnisse sprechen als gegen eine Literatur, die sie nur geradlinigst wiedergibt und sich auf das Wiedererkennungsgenicke der Leser verlassen kann.
Ihre Leistung besteht darin, trotzdem nicht langweilig zu sein.
Das ist ein Phänomen, das man auch von Schweizer Gestaltern und Architekten kennt: Reduktion bis zur Kargheit, Gediegenheit durch Askese, Eleganz durch Konvention, Handwerk statt Genialischem. Nicht nur tun, was man kann, sondern können, was man tut.
Am Ende sind es die gleichen Gründe, aus denen man die Schweiz auch sonst liebt und manchmal hasst, im Grunde aber doch eher liebt, auch wenn das natürlich Klischees sind. Also die Druckflächen der Wahrheit.
PETER RICHTER
Martin Suter: "Der Koch". Diogenes, 272 Seiten, 21,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Martin Suter gilt als Meister einer eleganten Feder, die so fein geschliffen ist, dass man die Stiche oft erst hinterher spürt.«