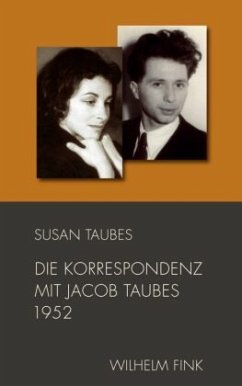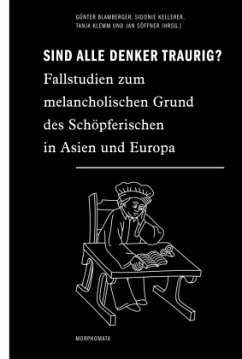Nicht lieferbar

Der Krieg und der Ausfall der Sprache
Habil.-Schr.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Trotz einer langen geistesgeschichtlichen Tradition der Hegung und Begrenzung von Gewalt ist Krieg offensichtlich ein "erfolgreiches Konzept", das sich als Interaktion immer wieder gegen andere Handlungsoptionen durchsetzt. Im Kontrast zu herkömmlichen Ansätzen der Kriegsursachenforschung, Konflikttheorien und auch philosophischen Positionen wird die These vertreten, dass sich der Krieg als "Urschrift" eines Verrats, eines Missbrauchs und einer Auslöschung der Sprache bedient. Mit einer eigenen Semantik und Syntaktik durchkreuzt er Rechts- und Friedensformen. Seine Dynamik entfaltet er in v...
Trotz einer langen geistesgeschichtlichen Tradition der Hegung und Begrenzung von Gewalt ist Krieg offensichtlich ein "erfolgreiches Konzept", das sich als Interaktion immer wieder gegen andere Handlungsoptionen durchsetzt. Im Kontrast zu herkömmlichen Ansätzen der Kriegsursachenforschung, Konflikttheorien und auch philosophischen Positionen wird die These vertreten, dass sich der Krieg als "Urschrift" eines Verrats, eines Missbrauchs und einer Auslöschung der Sprache bedient. Mit einer eigenen Semantik und Syntaktik durchkreuzt er Rechts- und Friedensformen. Seine Dynamik entfaltet er in vielfältigen Pendelbewegungen, seine Matrix sorgt für die Inauguration einer kriegerischen Ordnung als Kultur des Kriegs, und seine Diabolik bewirkt, dass der Krieg als Urschrift seine Spuren im Opfer hinterlässt und den sozialen Konjunktiv eines Friedens zerstört.