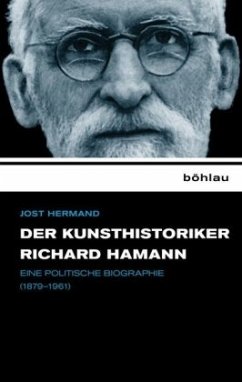Richard Hamann (1879-1961) war einer der bedeutendsten deutschen Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts. Er begründete das Marburger Bildarchiv und war zeitweiliger Vorsitzender des Kunsthistorikerverbandes. In den langen Jahren seiner Lehrtätigkeit von 1911 bis 1957 und in seinen zahlreichen Publikationen trat er stets energisch für die Durchsetzung einer leistungsbetonten Sachkultur ein und verwarf jedes gesellschaftliche Rangbewußtsein im Sinne personenkultischer Vorstellungen. Da er dieses Konzept selbst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in West- und Ostdeutschland vertrat, geriet er zusehends zwischen die Fronten des Kalten Kriegs und wurde dem-entsprechend an den Rand gedrängt. Jost Hermand versucht, dieser langanhaltenden Verfemung entgegenzutreten und das Vorbildliche der ideologischen "Haltung" Hamanns herauszustellen. Vor dem Hintergrund der zeitpolitischen Ereignisse entwirft er eine Biographie Richard Hamanns, der selber alles Ichbetonte abgelehnt hätte. Deshalb wirdder Hauptakzent vor allem auf Hamanns vielfältige Bemühungen gelegt, unter dem Motto "Theoria cum praxi" einer progressionsbetonten Kunst- und Kulturpolitik für Jedermann den Weg zu bereiten.

Die Kunst zu fotografieren: Zwei Studien über den Kunsthistoriker Richard Hamann
Das schöne Wort "Papiermuseum" erfand der Wissenschaftshistoriker Martin Rudwick, um die Tatsache zu bezeichnen, dass Urzeitforscher nicht nur Fossilien und Ausgrabungsstätten studieren, sondern auch Papier. Aus der Paläontologie wurde erst dann eine Wissenschaft, als man die fossilierten Knochen, Skelette und Gebeine abzeichnete: Im Medium der Zeichnung wurden die dreidimensionalen Objekte nicht nur zweidimensional - sie wurden auch besser transportierbar, skalierbar und damit vergleichbar.
Was für Dinosaurier und Mammuts gilt, trifft auch auf Gemälde, Skulpturen, Teppiche und Bodenmosaike zu: Erst als es mit der Fotografie gelang, eine einheitliche visuelle Sprache für die vielfältigen Objekte der Kunst zu entwickeln, wurde aus der Kunstgeschichte eine wissenschaftliche Disziplin. Die Voraussetzung dafür, sich untereinander verständigen zu können, war nicht, zu den Originalen zu reisen und sie zu betrachten, sondern umgekehrt, die Kunst in die Institute kommen zu lassen - in Form von Fotografien und Lichtbildern. Dies ist die überzeugende These der Kunsthistorikerin Angela Matyssek, in die sie ihre umfangreiche Studie zu Richard Hamann einbettet ("Kunstgeschichte als fotografische Praxis. Richard Hamann und Foto Marburg", Berlin 2009).
Der Marburger Historiker stellt einen herausragenden Fall der Konjunktion von Kunst- und Fotografiegeschichte dar: Im Jahr 1913 gründete er mit Foto Marburg das prominenteste Archiv der deutschen Kunstgeschichte, das fünfzehn Jahre später bereits zwischen 40 000 und 50 000 Negativplatten besaß und über eine Million fotografischer Abzüge; die jährliche Produktion belief sich 1930/1 auf etwa 75 000 Kontaktbezüge. Hamanns utopischen Planungen zielten auf ein kunsthistorisches Weltarchiv, das seinen Sitz an einem zentralen Institut in Deutschland haben sollte.
Doch Angela Matyssek hat weit mehr als eine Monographie zu Hamann geschrieben. Mit der Sorgfalt eines Handbuchs werden von ihr sämtliche Unternehmungen aufgefächert, die sich mit dem Fotografieren von Kunst beschäftigten. Firmen etwa wie Braun und Hanfstaengl belieferten schon fünfzig Jahre zuvor sowohl Kunsthistoriker als auch Touristen, Heinrich Wölfflin thematisierte die Bedeutung des Lichtbilds für seine Kunstgeschichtsschreibung selbst. Und bereits 1865 forderte Herman Grimm, späterer Ordinarius für Kunstgeschichte an der Berliner Universität, die Einrichtung einer "fotografischen Bibliothek" und formulierte auch gleich, wie die Apparatur den Blick verändert hatte: "Wer war so toll früher, sich dem Gedanken hinzugeben, es sei doch eine schöne Sache, die Reihenfolge aller Werke eines großen Meister vereinigt zu sehen?" Als Paradebeispiel galt Grimm das von Prinz Albert initiierte Raffael-Projekt, für das systematisch alle Werke des Künstlers durchfotografiert worden waren.
Hamanns Projekt war eine Absage an den Persönlichkeits- und Geniekult der Kunstgeschichte, er wollte eine "Sachkultur" in seinem Fach etablieren. In Kunstwerken und Stilen sah er den Ausdruck sozialer Realitäten, der Kunsthistoriker sollte den "Kausalgesetzen der Kultur" auf den Grund gehen. Als Erbe hinterließ er, der 1961 starb, tatsächlich so etwas wie einen demokratisierten Blick: Objekten, die zuvor ignoriert worden waren, sprachen seine Fotografien plötzlich große Bedeutung zu. Mit seiner Kamera kletterte er in versteckte Winkel von Kirchenräumen und holte die entlegensten Objekte aus luftigen Höhen in die Räume der Kunstinstitute.
Die sozial engagierte Kunstgeschichte Hamanns steht im Zentrum der ebenfalls soeben erschienen Biographie, die der Literaturwissenschaftler Jost Hermand verfasst hat (Der Kunsthistoriker Richard Hamann. Eine politische Biographie, 1879-1961, Köln 2009). Dass Hamann nicht nur kritisch schrieb, sondern auch zur Zeit des Nationalsozialismus seinen jüdischen Kollegen beistand, ist auch von Matyssek ganz unbestritten. Im Gegensatz zu Hermand erwähnt sie allerdings auch, dass er, um finanzielle Unterstützung für große Fotoprojekte in den besetzten Gebieten von den Nationalsozialisten zu erhalten, seine Kunstgeschichte auch in ihren Dienst stellte. Die Fotografien galten als Belege des "Deutschtums" der Grenzregionen und gerieten damit ins Fahrwasser der Legitimation der Besetzung.
Hamanns Leben nicht ganz vollständig zu erzählen, ist offensichtlich der Preis, den Hermand dafür zu zahlen bereit ist, ihn als großes Vorbild für die Kunstgeschichte zu preisen. Als ertragreicher erweist sich Matysseks Ansatz, den strukturellen Beitrag Hamanns zur Kunstgeschichte klar herauszuarbeiten. Auch Hamann hätte daran wohl seine Freude gehabt: Der Persönlichkeitskult lag ihm ja schließlich nicht.
JULIA VOSS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Überhaupt nicht gelangweilt hat sich Frank-Rutger Hausmann nach eigenem Bekunden mit Jost Hermands Biografie des Kunsthistorikers Richard Hamann, und er sieht damit das umfangreiche und eindrucksvolle Werkspektrum des 79-jährigen emeritierten Kulturgeschichtlers um eine "politische Biografie" erweitert. Der Autor hat von 1955 bis 1961 in Marbach und Ost-Berlin zusammen mit Hamann an der Reihe "Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus" gearbeitet und zeigt zudem Sympathie für die politischen und wissenschaftlichen Standpunkte des als "linker Professor" geltenden Kunsthistorikers, erklärt der Rezensent. Er hat sich von der Lebensbeschreibung fesseln lassen und darin einen Kunsthistoriker entdeckt, der sich weder durch die Nationalsozialisten noch durch das DDR-Regime in seiner demokratischen und durch "Zivilcourage" geprägten Haltung beirren ließ, wie Hausmann eingenommen aus diesem Buch erfahren hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH