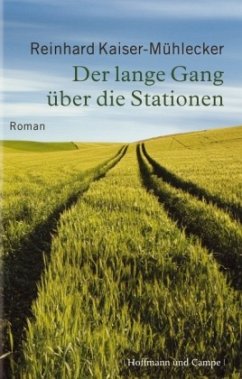Eine neue Stimme in der deutschsprachigen Literatur - schon vor Erscheinen preisgekrönt.
»Meine Frau war zu mir gezogen. Sie kam nicht aus der Gegend, sondern von weiter her, und
diese Umgebung hier war ihr noch recht neu und unbekannt. Und da, ganz am Anfang, war alles noch so einfach.«
Diese Sätze leiten den ersten Roman des jungen österreichischen Autors Reinhard Kaiser-Mühlecker ein. Scheinbar nüchtern berichtet ein Mann von sich. Er ist noch nicht lange verheiratet mit einer Frau aus der Stadt, lebt mit ihr und seinen beiden Eltern auf dem Hof der Familie, den er übernommen hat und bewirtschaftet. Diese Geschichte erzählt von zwei Menschen, die sich sehr nahe sind, zwischen denen aber immer mehr Fragen auftauchen, die unbeantwortet bleiben. Immer weniger versteht der Mann, was passiert, immer mehr hat er das Gefühl, dass die Entwicklungen ihm entgleiten. Eigentümlich ergreifend ist dieser Bericht, der ohne jede Interpretation auskommt, nichts erklärt, einfach nur beschreibt.
Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung
»Meine Frau war zu mir gezogen. Sie kam nicht aus der Gegend, sondern von weiter her, und
diese Umgebung hier war ihr noch recht neu und unbekannt. Und da, ganz am Anfang, war alles noch so einfach.«
Diese Sätze leiten den ersten Roman des jungen österreichischen Autors Reinhard Kaiser-Mühlecker ein. Scheinbar nüchtern berichtet ein Mann von sich. Er ist noch nicht lange verheiratet mit einer Frau aus der Stadt, lebt mit ihr und seinen beiden Eltern auf dem Hof der Familie, den er übernommen hat und bewirtschaftet. Diese Geschichte erzählt von zwei Menschen, die sich sehr nahe sind, zwischen denen aber immer mehr Fragen auftauchen, die unbeantwortet bleiben. Immer weniger versteht der Mann, was passiert, immer mehr hat er das Gefühl, dass die Entwicklungen ihm entgleiten. Eigentümlich ergreifend ist dieser Bericht, der ohne jede Interpretation auskommt, nichts erklärt, einfach nur beschreibt.
Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung

Tradition mit Haarrissen: Der österreichische Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker macht den Bauernroman zum Erzählexperiment.
Kaum etwas scheint dem radikal Neuen feindlicher gegenüberzustehen als das bäuerliche Leben. Gerade die deutschsprachige Literatur hat ihrem Beharrungsvermögen immer wieder große Literatur abgerungen - Erzähler wie Arnold Stadler oder Josef Winkler stehen für diese Anti-Heimat-Literatur, in denen sich ein Subjekt gegen die übermächtige, patriarchalische Welt des Herkommens zu behaupten hat. Der junge, auf dem elterlichen Hof in Öberösterreich aufgewachsene Reinhard Kaiser-Mühlecker dreht in seinem Debütroman dieses Schema um. Herausgekommen ist dabei ein wundersames und wunderbares Paradox: ein Bauernroman als Erzählexperiment.
Denn Kaiser-Mühlecker geht ein hohes Risiko ein, indem er die Perspektive eines Menschen einnimmt, der keinerlei Drang nach Veränderung oder auch nur Reflexion seiner ererbten Lebensbedingungen verspürt. Ich-Erzähler des Romans ist ein junger Bauer, der, etwa zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts, den kleinen elterlichen Hof übernimmt und sich eine Frau "von weiter her" holt. In einer einfachen, mitunter archaisierenden, aber sehr anschaulichen Sprache beschreibt er eine Welt, mit der er - zunächst - im Einklang lebt; man arbeitet hart, zum Seelenfrieden genügt die Gefährtin und gelegentlich eine selbstgedrehte Zigarette. Als Initiationsritus wandert er mit seiner Frau an Sonntagen familiäre Gedächtnisorte der Umgebung ab - der "Gang über die Stationen", der dem Buch den Titel gibt.
Beschreibung, aber nicht eigentlich Handlung, Statik statt Dynamik ist der Modus dieses Erzählens, die Inbesitznahme eines ererbten Grundes mit der Sprache. Als der Bauer seiner Frau auf einer Wanderung von seinem lange verstorbenen Großvater erzählen soll, denkt er: "Mir schien, auch für diese Lebensgeschichte . . . war das Einzige und Passendste, was man sagen konnte, nur: und so weiter und so fort. Und das auch dieses Leben, wie ein jedes, dahingegangen war bis zum Schluss."
Der Großvater also hätte noch keine Romanfigur abgegeben. Kaiser-Mühlecker erzählt nun von der Generation, in die Kette der Tradition zu rosten beginnt. Es bilden sich feinste Haarrisse in dieser scheinbar allen historischen Veränderungen enthobenen Idylle. Der Bauer erlebt seine erste Autofahrt. Es gibt Verstimmungen. Die Frau fühlt sich einsam, sie hat sich wohl in ihrem Mann getäuscht; er wiederum ist eifersüchtig auf eine Bekanntschaft aus früheren Zeiten. Der - aus seiner Sicht selbstverständliche - Wunsch nach Kindern ist der (unausgesprochene) Streitpunkt. Eine gemeinsame Reise nach Wien wird zum Debakel: Am Ende tanzt der betrunkene Provinzler in einer Bar Schuhplattler. Ökonomische Veränderungen tun ein Übriges, der Hof wird unrentabel, man übernimmt sich. Eine Welt zerbricht. Doch zum immergleichen Gang über die Stationen gibt es keinen Plan B.
Wie in einer Novelle des neunzehnten Jahrhunderts greift eins ins andere und führt mit Folgerichtigkeit zum fatalen Ende. Der Kunst dieses Debüts liegt in der Erzählhaltung, die ihren Gegenstand nie der Lächerlichkeit preisgibt; geschildert wird die ausweglose Lage eines Menschen, dem die Welt, mit der er anfangs doch ganz eins war, entgleitet und der sie nur wieder einholen könnte, wenn er sich selbst dafür aufgäbe. Kaiser-Mühlecker trägt auf allerengstem Raum den großen Kampf zwischen Tradition und Fortschritt aus, ohne sich auf eine Seite zu schlagen. Ein Buch, das als Debüt des Jahres 2008 genauso aus der Zeit gefallen scheint wie seine Hauptfigur, und das genauso unvergesslich bleibt.
RICHARD KÄMMERLINGS
Reinhard Kaiser-Mühlecker: "Der lange Gang über die Stationen". Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2008. 160 S., geb., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Tief beeindruckt ist Rezensent Christoph Schröder von Reinhard Kaiser-Mühleckers Debütroman "Der lange Gang über die Stationen". Er würdigt ihn als ein Buch, das völlig aus der Zeit fällt. Dass der Autor gerade einmal 25 Jahre alt ist, mag er kaum glauben. Der in den 1950er Jahren im oberösterreichischen Seengebiet angesiedelte Roman um einen jungen Bauern, der sich wirtschaftlich übernimmt und hilflos mitansehen muss, wie ihm seine schöne Frau mehr und mehr entgleitet, zeichnet sich für Schröder durch seine Sprache und seinen Blick auf die Welt aus. Der Tonfall des Ich-Erzählers wirkt auf ihn fast ein wenig altmodisch, aber dabei niemals "aufgesetzt" oder "folkloristisch", sondern "höchst authentisch". Besonders lobt Schröder die genaue, feinsinnige, diskrete Beschreibung der "atmosphärischen Veränderungen" in der Beziehung des Jungbauern und seiner Frau.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH