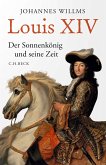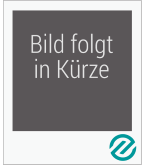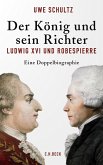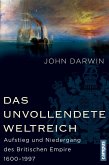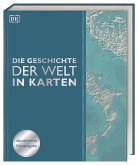Schon vor der Französischen Revolution gab es gelegentliche Hinrichtungen durch das Fallbeil, aber erst ab 1791 kommt der Tod auf dem Schafott flächendeckend und für alle zum Einsatz. Bis dahin entschieden der gesellschaftliche Stand und die Art des Verbrechens über die Wahl der Hinrichtungsmethode. Nun hält die Industrialisierung des Tötens Einzug. Denn vor der Guillotine werden alle gleich.
Und während die Zeitgenossen angesichts all der abgeschlagenen Köpfe noch rätseln, ob das Bewusstsein der Geköpften vom Körper getrennt noch weiterleben kann, entwirft László F. Földényi in seinem bildreichen Essay seine ganz eigene Erzählung des langen 19. Jahrhunderts - ausgehend von unserem Eintritt in die Kopflosigkeit. Zur gleichen Zeit hält auch die neue Technik der Fotografie Einzug. Erst ihre flächendeckende Verbreitung ermöglicht es, den Moment aus der Vergänglichkeit des Lebens zu lösen, ihn gleichermaßen zu verewigen wie zu töten. Das führt nicht nur zu einem neuen Verständnis von Zeit und Raum, sondern zu einer Veränderung der Wahrnehmung selbst. Als würde der Schnitt des Fallbeils sich ab da unendlich fortsetzen, wirkt fortan alles fragmentiert: die Körper, die Stadt, die Dichtung und die Malerei. Ein ganz und gar neues Bild des Menschen entsteht, das ihn als ein bizarres, ein gewaltlüsternes, ein kopfloses Wesen zeichnet und das bis in unsere Gegenwart fortwirkt.
Und während die Zeitgenossen angesichts all der abgeschlagenen Köpfe noch rätseln, ob das Bewusstsein der Geköpften vom Körper getrennt noch weiterleben kann, entwirft László F. Földényi in seinem bildreichen Essay seine ganz eigene Erzählung des langen 19. Jahrhunderts - ausgehend von unserem Eintritt in die Kopflosigkeit. Zur gleichen Zeit hält auch die neue Technik der Fotografie Einzug. Erst ihre flächendeckende Verbreitung ermöglicht es, den Moment aus der Vergänglichkeit des Lebens zu lösen, ihn gleichermaßen zu verewigen wie zu töten. Das führt nicht nur zu einem neuen Verständnis von Zeit und Raum, sondern zu einer Veränderung der Wahrnehmung selbst. Als würde der Schnitt des Fallbeils sich ab da unendlich fortsetzen, wirkt fortan alles fragmentiert: die Körper, die Stadt, die Dichtung und die Malerei. Ein ganz und gar neues Bild des Menschen entsteht, das ihn als ein bizarres, ein gewaltlüsternes, ein kopfloses Wesen zeichnet und das bis in unsere Gegenwart fortwirkt.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ein faszinierendes Buch hat László F. Földényi geschrieben, findet der hier rezensierende Historiker Volker Reinhardt, der prospektive Leser allerdings auch warnt: Sie sollten schon wissen, worauf sie sich hier einlassen. Thema des Buches ist der lange Schatten der Guillotine, also jener Enthauptungsmethode, die 1792 erstmals in Paris eingesetzt wurde und von Anfang an die Pariser Zeitgenossen faszinierte. Unter anderem interessierten sie sich dafür, wie die Guillotinierten ihre eigene Guillotinierung erlebten, erfahren wir. Im Stil der Surrealismus assoziiert sich der Autor laut Reinhardt durch die Sozial- und Technikgeschichte, für ihn hat auch die Fotografie mit der Guillotine zu tun, da sie in ihrer Frühphase aufgrund langer Belichtungszeiten Menschen aus den Bildern heraus löschten; während die Pariser Stadtplanung in Földenyis Assoziation eine menschenfeindliche urbane Umgebung schuf. Ziemlich schwindelerregende Gedanken versammelt dieses die Wege des Unterbewussten erkundende und am Ende gar der "Enthirnung" der Menschen das Wort redende Buch, so Reinhardt, der das mit Interesse liest, aber auch ein paar mögliche Gegenargumente anbringt, etwa was die bewahrende Funktion der Fotografie betrifft. Am Ende steht eine Leseempfehlung, verbunden mit dem Hinweis auf die Gefahr von Alpträumen nach der Lektüre.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH