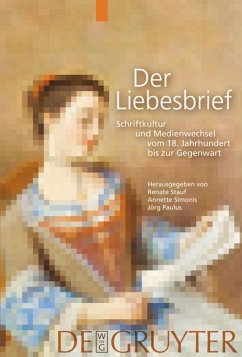If somebody in the 18th century had wanted to send a love letter using SMS text, they would have been doomed to fail ? neither the technology nor the recipient would have been able to handle such a flood of emotional signs. Why is that? The present volume collects contributions from a variety of disciplines dealing with hitherto neglected questions of a cultural history of the love letter. The results are surprising ? the love letter has its own rules, and is far more independent from the development of other forms of written culture than was previously assumed.
Was wir uns unter einem Liebesbrief vorstellen, ist mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft und der Herausbildung des Individuellen eng verbunden.
In welcher Gestalt aber wurde die Erfindung des bürgerlichen Liebesbriefs im 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit ihren medialen Brüchen fortgeschrieben? Gibt es eine Invarianz der Liebessprache in Briefen, oder sind sie Teil der allgemeinen Entwicklung der Schriftkultur? Im vorliegenden Band eines Braunschweiger Forschungsprojekts zur Liebesbriefkultur sind Beiträge versammelt, die sich diesen bisher kaum erforschten Fragen stellen. Experten aus Literaturwissenschaft, Theologie und Wissenschaftsgeschichte stellen autor- und problemorientierte Zugänge vor: von Lessing und Eva König zu Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze, vom englischen Briefroman des 18. Jahrhunderts zu SMS und MMS. Die Ergebnisse überraschen: Offenkundig hat die Sprache der Gefühle ein freieres Spiel im Kultursystem als dies bisher angenommen wurde. Der Liebesbrief entwirft als Dokument alltäglicher kultureller Praxis ein Schrift- und Zeitregime eigener Ordnung und ist als Phänomen sui generis zu betrachten: Es gibt eine spezifische Liebesbriefkultur, die ihre Eigenart zwischen vorgegebenen Diskursangeboten und privatsprachlicher Intimität entfaltet und behauptet. Der vorliegende Band legt einen wichtigen Grundstein zu ihrer Erforschung.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Was wir uns unter einem Liebesbrief vorstellen, ist mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft und der Herausbildung des Individuellen eng verbunden.
In welcher Gestalt aber wurde die Erfindung des bürgerlichen Liebesbriefs im 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart mit ihren medialen Brüchen fortgeschrieben? Gibt es eine Invarianz der Liebessprache in Briefen, oder sind sie Teil der allgemeinen Entwicklung der Schriftkultur? Im vorliegenden Band eines Braunschweiger Forschungsprojekts zur Liebesbriefkultur sind Beiträge versammelt, die sich diesen bisher kaum erforschten Fragen stellen. Experten aus Literaturwissenschaft, Theologie und Wissenschaftsgeschichte stellen autor- und problemorientierte Zugänge vor: von Lessing und Eva König zu Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze, vom englischen Briefroman des 18. Jahrhunderts zu SMS und MMS. Die Ergebnisse überraschen: Offenkundig hat die Sprache der Gefühle ein freieres Spiel im Kultursystem als dies bisher angenommen wurde. Der Liebesbrief entwirft als Dokument alltäglicher kultureller Praxis ein Schrift- und Zeitregime eigener Ordnung und ist als Phänomen sui generis zu betrachten: Es gibt eine spezifische Liebesbriefkultur, die ihre Eigenart zwischen vorgegebenen Diskursangeboten und privatsprachlicher Intimität entfaltet und behauptet. Der vorliegende Band legt einen wichtigen Grundstein zu ihrer Erforschung.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Es werden nicht mehr so viele Liebesbriefe geschrieben. Jedenfalls nicht mehr in der früheren Menge und Form. Die Jugend zieht seit kurzem E-Mail und seit langem schon endlose Telefonate vor, jetzt auch das "Skypen" (irgend so eine Mischung aus Telefonieren, Fernsehen und Brief) oder den Austausch über Internet-Plattformen. Außerdem ist die Wirkungsmacht der Distanz durchs moderne Transportwesen geschwächt worden. Früher musste der Verliebte aus Hamburg der Geliebten in Bremen schreiben, heute fährt er einfach hin. Was das für die Empfindungen im Allgemeinen und für die Literatur im Besonderen bedeutet, ist wenig erforscht, weil sich meistens nicht die besten Forscher um so etwas kümmern, sondern oft nur Leute, die gern den Eindruck zu erwecken suchen, sie säßen im Cockpit der Technologiegeschichte und sähen die Zukunft.
Aber ändert die Art der Zustellung wirklich das, was mitgeteilt wird? Muss man sich Sorgen machen, nur weil keine Postwertzeichen mehr aufgeklebt werden und die Handschrift entfällt? Ein gerade herausgekommener sehr lesenswerter Band zur Kulturgeschichte des Liebesbriefs enthält unter 19 Beiträgen überhaupt nur einen einzigen und nicht einmal einen besonders aufschlussreichen zum Übergang vom Brief zur "Mail" ("Der Liebesbrief. Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart", hrsg. von Renate Stauf u.a., Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2008).
Und doch führt der Band in eine Epoche voller Anregungen für unsere eigene - weil es unsere eigene ist. Man lernt vor allem, wie schwierig es bleibt, Romantik im Liebesbrief zu vermeiden. Es sei denn, man ist König von Preußen und kann sich wie Friedrich Wilhelm II. auf Mitteilungen an die Mätresse wie "ich werde zuletzt noch dol vor lauter liebe werden" beschränken. Schon Bismarck hingegen, der sich romantisch korrekt auf einer Harzreise verliebte, folgte auch in den Briefen an die Braut dem um 1800 eingeführten Vokabular - "Küsse lassen sich nicht schreiben" - und tauscht sich mit ihr über traurige englische Gedichte aus. Selbst im streckenweise fabulierfreudigen und trocken witzigen Briefwechsel zwischen Lessing und Eva König - "herzenskluger Verzicht auf die Pathetik des Gefühls" notiert die Philologin Irmela von der Lühe dazu - kommt es zu kleinen Exzessen. Lessing beispielsweise schreibt einmal lange nicht, stellt sich dann in seinem nächsten Brief vor, dass eben diese lange Pause der Geliebten nahelege, schlecht über ihn zu denken - und tadelt sie dafür!
Schon damals zeigte sich mithin, dass das Gelingen liebreicher Fernmitteilungen von der Einsicht der Beteiligten darin abhängt, wie viel Übertreibungen allein schon das Briefmedium nahelegt. Exzentrizität beweist hier Intimität, Stimmungsschwankung Stimmung. Und also neigt, dies das Ergebnis des Bandes, in Liebesdingen das Schreiben dazu, sich zu verselbständigen. Am stärksten geschah das vielleicht bei Jean Paul. Der legte Liebesbriefe, die er erhalten hatte, Dritten vor und imaginierte ein System der "Simultanliebe". Das sollte schriftlich funktionieren und alle möglichen Freund- und Liebschaftsnetzwerke mit dem Knotenpunkt Jean Paul verknüpfen. Fast scheint es, als sei hier die Liebe in den Dienst des Briefeschreibens gestellt worden und nicht das Schreiben in den ihren. Die Vollzugslust hing jedenfalls ganz am Formulieren und am Lesen.
Ganz folgerichtig, dass eine Zeitlang der Briefroman die beliebteste Gattung war. Wenn sich auch hier das Schreiben vors Beschriebene schob und die Emotion von ihrer Beschreibung überformt wurde, deuten manche Literaturwissenschaftler das moralisch. Nicht um den Gefühlsausdruck, sondern um die Disziplinierung von Liebesregungen sei es gegangen. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Barbara Benedict hat darum einmal von "redaktionell bearbeiteten Gefühlen" gesprochen, die im Zentrum der empfindsamen Literatur stünden. Aber das unterschätzt erneut den Eigensinn der Literatur. Für Samuel Richardsons "Pamela", das Urmodell aller empfindsamen Briefbücher, hat man beispielsweise ausgerechnet, dass der Titelheldin bei ihrer Schreibfrequenz und der Länge ihrer Briefe gar keine Zeit mehr für das Erleben dessen geblieben wäre, wovon sie handeln.
Wenn der Briefroman nach ein paar Jahrzehnten, in denen er die dominante Erzählform war, dann fast verschwand, mochte das mit Lerneffekten zusammenhängen. Das Lesepublikum hatte gewissermaßen sein Liebespensum hinter sich, all die angeblichen Unsagbarkeiten, erwartbaren Komplikationen und Gefühlsredigate waren Bestandteil des allgemeinen Repertoires geworden. Für solche Lerneffekte gibt es auch private Beispiele. Kaum sind Bismarck und Johanna von Puttkamer verheiratet, geht es in ihren Briefen plötzlich nicht mehr um Literatur und Religion, schwindet der Übermut aus den Zeilen und legt das Berichten der Lyrik die Feder aus der Hand.
JÜRGEN KAUBE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Mag sein, daß sich so mancher Leser des vorliegenden Bandes von der Fülle der faszinierenden Beispiele dazu inspirieren läßt, selbst einmal wieder zur Liebesbrieffeder zu greifen." Till Kinzel in: Informationsmittel (IFB) 1-2/2008
"Ein überzeugender Anfang wissenschaftlicher Aufarbeitung ist mit dem vorliegenden Werk getan."
Ulrike Leuschner in: Arbitrium 3/2009
"sehr lesenswerter Band zur Kulturgeschichte des Liebesbriefs"
Jürgen Kaube in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.05.2009
Ulrike Leuschner in: Arbitrium 3/2009
"sehr lesenswerter Band zur Kulturgeschichte des Liebesbriefs"
Jürgen Kaube in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.05.2009