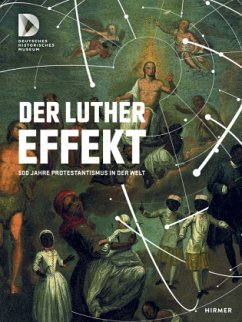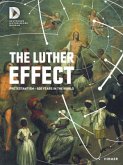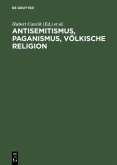Martin Luther hat in seinem Leben nur ein einziges Mal die Alpen überquert, als er als fast 30jähriger Mönch mit anderen Ordensbrüdern nach Rom reiste. Die „Stadt der Päpste“ beeindruckte ihn allerdings nur mäßig. Luthers Welt war überschaubar, er bewegte sich sein Leben lang in engen Grenzen. Seine
Ideen und Werke lösten jedoch eine weltweite Bewegung aus, die bis heute anhält und zu der sich…mehrMartin Luther hat in seinem Leben nur ein einziges Mal die Alpen überquert, als er als fast 30jähriger Mönch mit anderen Ordensbrüdern nach Rom reiste. Die „Stadt der Päpste“ beeindruckte ihn allerdings nur mäßig. Luthers Welt war überschaubar, er bewegte sich sein Leben lang in engen Grenzen. Seine Ideen und Werke lösten jedoch eine weltweite Bewegung aus, die bis heute anhält und zu der sich mehr als 800 Millionen Menschen rund um den Erdball bekennen.
Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums präsentiert das Deutsche Historische Museum Berlin im Martin-Gropius-Bau die Ausstellung „Luthereffekt“ (12. April - 5. November 2017), die nach den Spuren sucht, die der Protestantismus weltweit hinterließ. Bereits vor Luther war in Kirchenkreisen die Auffassung weit verbreitet, dass die Kirche einer „Reform an Haupt und Gliedern“ bedürfe, aber erst mit Luther kam Bewegung in diesen Reformstau. Dabei war sein Auftreten gleichzeitig ein regionales, nationales und globales Ereignis. Das Echo und die Aufmerksamkeit, die seinen Schriften zuteil wurden, überschritten dabei politische und sprachliche Grenzen.
Im Hirmer Verlag ist der umfangreiche und reich illustrierte Begleitkatalog zu dieser bemerkenswerten Ausstellung erschienen, der mit zahlreichen Essays die „Luthereffekte“ in ausgewählten Regionen beleuchtet. Am Beispiel des Schwedischen Reiches, das damals dünn besiedelt und bäuerlich geprägt war, wird anschaulich dokumentiert, wie die Reformation in Nordeuropa schnell Fuß fasste. Bereits 1527 setzte der schwedische König Gustav Wasa die Trennung von Rom durch und in der Folge entwickelte sich eine lutherische Staatskirche und ein konfessionell einheitlicher Staat, der nach dem Westfäli-schen Frieden von 1648 zu einer lutherischen Großmacht wurde.
Mit der europäischen Expansion gelangte das reformatorische Gedankengut auch nach Übersee. Diese „Globalisierung“ der Reformation wird in drei gesonderten Länder-Kapiteln herausgearbeitet: Vereinigte Staaten von Amerika, Korea und Tansania. Durch die Einwanderung verschiedener Gruppen und Konfessionen gelangte der Protestantismus in die britischen Kolonien Nordamerikas und entwickelte sich dort sehr vielgestaltig. Er trug dabei erheblich zur Entwicklung der amerikanischen Nation und zur Ausbildung ihres Selbstverständnissen bei. Eine Staatskirche existiert aber bis heute nicht, stattdessen stehen viele unabhängige Kirchen nebeneinander.
In Korea gibt es seit dem 19. Jahrhundert protestantische Gemeinschaften, Missionare konnten sich aber erst ab den 1880er Jahren dauerhaft ansiedeln. Heute ist Korea (vor allem Südkorea) das einzige ostasiatische Land mit einem großen protestantischen Bevölkerungsanteil. Nach der Teilung des Landes hatten die meisten Christen Nordkorea verlassen und das Verhältnis in dem geteilten Land ist weiterhin eine Schlüsselfrage für die beiden protestantischen Kirchen.
Der tansanische Protestantismus ist vielgestaltig, wobei die Evangelisch-Lutherische Kirche (ELCT) mit sechs Millionen Mitgliedern die größte lutherische Kirche Afrikas und die zweitgrößte der Welt ist. Heute beschränkt sich ihr Einfluss nicht mehr nur auf das eigene Land; Missionare aus Tansania arbeiten auf dem ganzen Kontinent. Gegenüber den Kirchen in Europa sehen sie sich als Vertreter der ursprünglichen Ideale Luthers. Der abschließende Ausblick setzt sich dann mit „Reformation global?“ auseinander, wo in der heutigen Zeit zahllose neue Religionen mit den etablierten Weltreligionen konkurrieren.