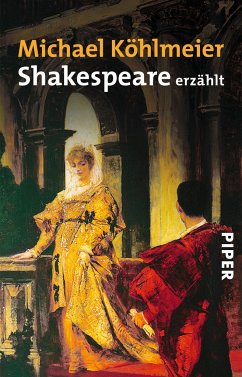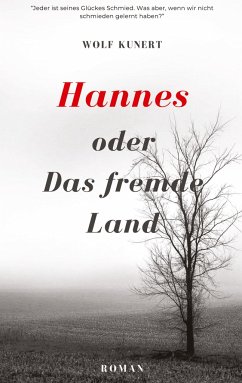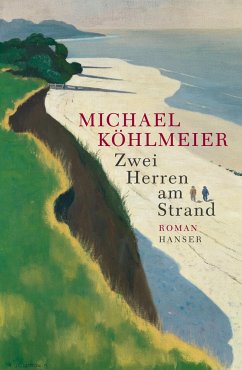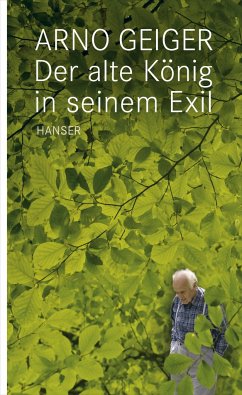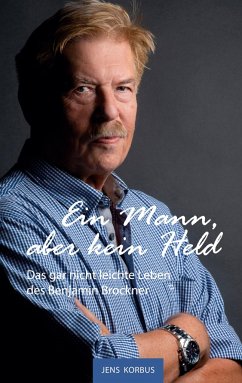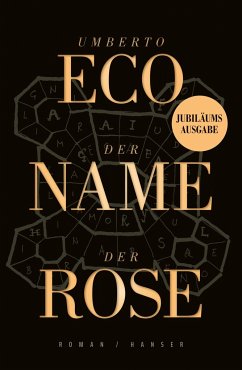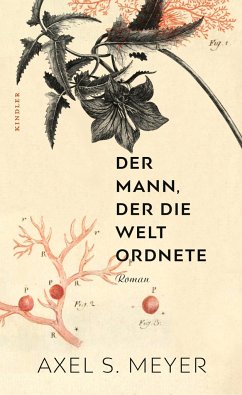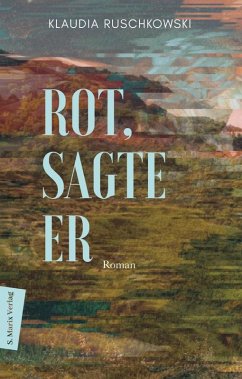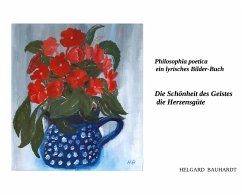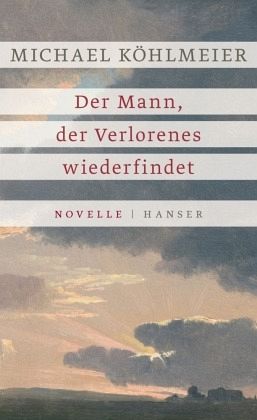
Der Mann, der Verlorenes wiederfindet
Novelle

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Antonius liegt auf dem Platz vor der Kirche. Er hatte die Schmerzen nicht mehr ertragen, die Straße nach Padua war gepflastert und der Wagen hart gefedert. Jetzt liegt er da und sieht den italienischen Himmel. Und er erinnert sich an alles, was ihn hierhergebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis in den Orden des heiligen Franziskus. - Michael Köhlmeier erzählt, wie nur er es kann, von einer sehr fernen Zeit, doch er macht uns den Bruder Antonius zum Zeitgenossen. In einer Epoche voller Gewalt fragt sich Antonius, wie kommt das Böse in die Welt? Habe ich etwas dagegen bewirkt mit mein...
Antonius liegt auf dem Platz vor der Kirche. Er hatte die Schmerzen nicht mehr ertragen, die Straße nach Padua war gepflastert und der Wagen hart gefedert. Jetzt liegt er da und sieht den italienischen Himmel. Und er erinnert sich an alles, was ihn hierhergebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis in den Orden des heiligen Franziskus. - Michael Köhlmeier erzählt, wie nur er es kann, von einer sehr fernen Zeit, doch er macht uns den Bruder Antonius zum Zeitgenossen. In einer Epoche voller Gewalt fragt sich Antonius, wie kommt das Böse in die Welt? Habe ich etwas dagegen bewirkt mit meinen Reden? Köhlmeier erzählt von dem Menschen Antonius, und der geht uns alle an.