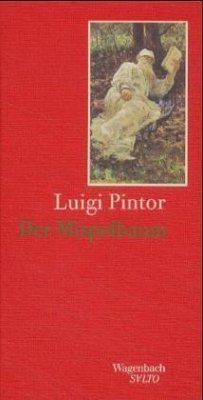Niemand kennt die Rezeptur des Glücks - so beginnt der Kolumbianer Hector Abad sein Handbuch zur kulinarischen Aufhellung des Gemüts. Und fährt fort, mit weisen, bisweilen höchst bizarren Verordnungen den zahlreichen Variationen des Unglücks zu Leibe zu rücken, denen die Frauen dieser Welt, aber nicht sie allein, ausgesetzt sind - das Alter, Schwiegermütter, die Einfälle der Männer, die Verzweiflung zu zweit, um nur einige zu nennen. Dies ist zwar ein Buch für den Gebrauch in der Küche, aber auch als Handbuch zur Behandlung unnützer Leidenschaften wird es seinen Dienst versehen. Sie mögen seltsam klingen, aber man sollte sie trotzdem ausprobieren, jene Rezepte, in denen sich das Horn eines Triceratops aus dem Pleistozän, drei Wochen lang auf kleiner Flamme gekocht, in ein sicheres Mittel gegen Schuldgefühle verwandelt.

Wozu Zukunft, wenn die Vergangenheit so reich an Ärgernissen ist: Luigi Pintor findet, er habe im Leben nichts falsch gemacht
Mispeln, so lehrt uns die Botanik, sind "meist dornige Sträucher oder kleine Bäume mit einfachen, oft eingeschnittenen, gelappten Blättern, einzelnen oder zu wenigen endständigen oder häufiger in reichblütigen Ebensträußen stehenden Blüten und mehliger Frucht, welche die steinhart gewordenen Fruchtblätter einschließt". Unter solch eine mickrige Pflanze voll filziger Blätter flüchtet sich Luigi Pintors Erzähler zum Philosophieren und gibt damit die kynische Grundhaltung des Gedankenbuches vor: Mögen sich andere unters angenehme Laubdach großer Bäume zurückziehen oder im gepflegten Garten Rosendüfte schnuppern - der bedürfnislose Denker hat an einem ruppigeren Gewächs Genügen.
Nun ist die Wahl einer Symbolpflanze in der italienischen Literatur keineswegs bedeutungslos, orientiert sich Pintor damit doch an einem der größten Dichter und Denker seiner Kultur, am Pessimisten Giacomo Leopardi, der in seinem kargen Heimatstädtchen Recanati einst das Lob des unausrottbaren Ginsters sang. Und gar nicht zufällig taucht in Pintors Mispelbriefen "der Bucklige von Recanati" unweigerlich auf. Wir befinden uns also im struppigen Gelände der mediterranen und daher stets gelinde rhetorischen Verzweiflung, haben den Grundton von Jammer und Weltabgewandtheit gleich assoziativ vorgegeben bekommen. Und Pintor, ein offenkundig belesener Mann, enttäuscht seine Leser nicht.
Es handelt sich um eine Art loses Tagebuch der Jahre 1997 bis 1999, die der Gründer des linken "Manifesto" und frühere kommunistische Parteizeitungsredakteur hier vorlegt, bezeichnenderweise eben in Anspielung auf des unideologischen Leopardi Gedankenbuch "Zibaldone" und nicht etwa im Gefolge der systematischeren Vordenker Lenin, Marx oder Mao, wenngleich jene Herren mehr oder weniger ausgesprochen präsent sind in dieser literarischen Lebensabrechnung.
Der Autor ist Jahrgang 1925 und bezeichnet sein literarisches Alter ego etwas kokett und abermals in einer Allusion auf Ippolito Nievos Greisenroman "Pisana" als "Hundertjährigen". Aus dieser Wipfelperspektive schreibt sich Pintor die Trauer über den Verlust zweier Kinder von der Seele, verbrämt sich und die Familie hinter Stereotypen und räsoniert im Bewußtsein der Vergeblichkeit über das unauslotbare Warum. So erklärt sich die Bitterkeit, mit der er über die Grausamkeit des Schicksals hadert: "Sagt nicht, das Schicksal sei blind, es sieht hervorragend und macht sich einen Spaß daraus." Dieser assoziative und sentenzenhafte Stil - in Deutschland bekannt von Johannes Gross etwa oder Jürgen Manthey - gebiert immer wieder kluge Beobachtungen, beispielsweise diejenige, daß Tarzan im Dschungel eine lange Mähne trägt, aber stets tadellos rasiert ist. Es rutschen aber auch zahlreiche Gemeinplätze in den Text, bei denen der Autor der eigenen Bedeutsamkeit auf den Leim geht, etwa so: "Der Monat Januar verdankt seinen Namen dem unzuverlässigen heidnischen Gott Janus mit seinem Doppelgesicht, dem er gewidmet wurde, weil es immer günstig ist, sich jedweden Mächtigen durch Schmeicheleien gewogen zu machen. Janus war anscheinend sehr gefürchtet, wenn er den ersten Monat im Kalender verdiente. Das veränderte jedoch nicht den Charakter des Gottes, und so bleibt der Januar der kälteste Monat des Jahres." Aus solcher Küchenphilologie lernen wir nicht viel. Und es sind denn auch nicht so sehr Erkenntnisse, die Pintor uns mitzuteilen hat, sondern eher Stimmungen. Hier spricht ein alter Kommunist, was die gleich doppelte Verbitterung des gewählten Alias namens Giano erklären hilft. Zum einen finden wir die altbekannte Altmännernostalgie, gemäß deren früher alles besser war: Das Licht in Rom war noch nicht vom Smog verdüstert, es gab keine Fernseher, keine Computer, kein Klonen. Pintor gedenkt zärtlich dessen, was alte Menschen im Überfluß haben, nämlich der Vergangenheit, und verachtet, was alte Menschen nicht haben, nämlich die Zukunft.
Was die Gegenwart angeht - und das ist das zweite Ingrediens der Weinerlichkeit -, segelt Pintor im seichten Gewässer altlinker Sicherheiten. Er gehörte einer ebenso tragischen wie lebensgeschichtlich verschonten Generation an, die aus dem Widerstand gegen den Faschismus in den Kommunismus geriet, sich daran zeitlebens abarbeitete und nun - im gesetzten, privilegierten Zustand - sich mit dem herrschenden Globalkapitalismus aus guten Gründen reibt. Allein, wie lassen sich Irrtümer und Verbrechen der eigenen Fraktion rechtfertigen? Woher kann ein Widerlegter noch den hohen Ton der Welterklärung nehmen? Darum begnügt sich der Autor in der Pose eines bedürfnislosen Diogenes mit Hinweisen auf die vielen Armen im amerikanischen System, auf den Völkermord an den Indianern, reibt sich in gut ultramontaner Tradition am Katholizismus und der Bibel, oder er reitet in einem kurzen Rückfall in die Politik vage Attacken auf den Kosovo-Krieg, dessen Berechtigung er überhaupt nicht einsieht und damit wieder einmal blind bleibt für die Leiden derjenigen, die für seine - diesmal pazifistische - Ideologie mit dem Leben zahlen müssen.
Doch Pintor stammte nicht aus einem Land, in dem sogar die Ideologen selbstironischer und weniger eisenhart sind als anderswo, wenn er nicht ab und zu die eigene Linientreue auf den Arm nehmen könnte: "Viele Jahre seines Lebens hat er damit zugebracht, eingeschlossen in einem Raum für Zeitungen gegen irgend etwas oder gegen irgend jemand zu schreiben . . . Was er tat, half nichts, schien ihm aber von größter Wichtigkeit." Bündiger läßt sich ein Journalistenleben wohl kaum zusammenfassen.
Auch sonst versucht Pintor weitgehend, im gewollt naiven, hintersinnigen, anarchischen Ton der Kürzestgeschichten Luigi Malerbas zu bleiben, oder er übt sich in der traurigen Poesie, mit der Gianni Celati die industrielle Zerstörung der Po-Landschaft beschrieb. Allerdings zeigt Pintor nicht den Tiefgang und den Witz seiner italienischen Vorbilder. Nein, leider ist dieser für Italiens Linke so verdienstvolle politische Journalist kein großer Schriftsteller, wenn er auch mit über Siebzig das Bedürfnis nach einem Sentenzenbuch verspürte.
Was einem so vom Leben enttäuschten, mit dem Tod unversöhnten Menschen noch bleibt? Larmoyanz. Sie zeichnet die langweiligsten Betrachtungen des Buches aus. Denn Larmoyanz ist allzuoft nur eine Trägheit des Geistes, weil man mit ihr hurtig über alte Ansichten und Gewißheiten hinweggehen kann, ohne sich ihrer noch schämen zu müssen. Wenn alles mies und egal war, war auch nichts wirklich verkehrt.
Doch es wäre schade, bliebe vom verdienstvollen und bis heute weiterbestehenden Engagement der Linken in Italien und anderswo einzig die Verachtung der Politik übrig, welcher der Greis Pintor trotzige Worte verleiht: "Die Politik ist ein Surrogat, dessen Haltbarkeit abgelaufen ist, eine Technik, um die Ideale, von denen sie lebt, zu entwerten, himmelweit entfernt von den Menschen, die ihr vertrauen." Das ist denn doch etwas billig. Pintor endet in rhetorischer Verzweiflung mit einer Lobpreisung des ewig fließenden und reinigenden Wassers, wohl wissend, daß mit Pindars "Das beste ist das Wasser" vor langer, langer Zeit unsere Poesie ihren Anfang nahm. Doch es ist gewiß nicht dieser Autor unterm Mispelstrauch, dem dazu das letzte Wort gebührt.
Luigi Pintor: "Der Mispelbaum". Aus dem Italienischen übersetzt von Friederike Hausmann. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2002. 92 S., geb., 10,90
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ganz und gar nicht überzeugend findet der Rezensent David Wagner dieses schmale Buch. Ohne rechte Höhen "rilkt, dantet und leopardisiert" sich der italienische Autor Luigi Pintor mit seiner altersweisen Hauptfigur Giano doch ohne bestimmte Zielsetzung durch Themen wie das Wetter und die Jahreszeiten, meint der Rezensent etwas boshaft. Eine schlechte Imitation des großen "Gedankensammelsuriumschreibers" Leopardi sei das. Auch durch ein paar "originellere" Feststellungen wie die über die grundsätzliche Bartlosigkeit des Kinohelden Tarzan werden die eher unfreiwillig komischen Sätze nicht aufgewogen. Und da die "Schwelle zum Poetischen" wirklich an keiner Stelle überschritten werde, fragt sich Wagner schließlich, wie das zu verteidigen ist. Wohl vom Agenten oder Verleger überredet worden, vermutet er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein kleines Meisterwerk. Rezepturen in Poesie, die die Phantasie mit Duft erfüllen." (Klaus Trebes, Die Woche)