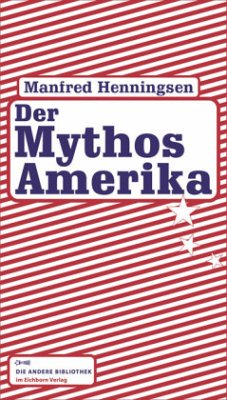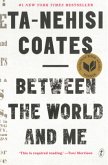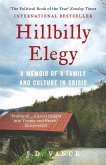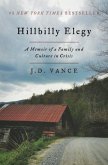Allen Krisen zum Trotz: Die politischen Eliten Amerikas pflegen das Selbstbild eines auserwählten Amerikas. Manfred Henningsen über die fatalen Folgen eines überlebten Mythos und die Chancen der wichtigsten Weltmacht, sich endlich der Wirklichkeit zu stellen._Demokratisches Sendungsbewusstsein und machtpolitischer Anspruch auf strategische und ökonomische Vorherrschaft prägen das amerikanische Selbstbild. Das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten entspringt einem populären, heroischen Geschichtsbild, in dem die dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit nur am Rand auftauchen. Die latente Weigerung, die gewalttätige eigene Gründungsgeschichte samt ihren genozidalen Aktionen gegen die indianischen Völker des Kontinents, der Sklaverei und des Rassismus als Erblast des Amerikanismus anzuerkennen, verstellt immer noch den Blick der politischen Elite auf das eigene Land. Nicht Folter und Rechtsbruch im Kampf gegen den Terrorismus prägen den politischen Diskurs, sondern die klangvolle Rhetorik amerikanischer Auserwähltheit und der Chance jedes Einzelnen, den amerikanischen Traum zu leben._Manfred Henningsen, der seit vielen Jahrzehnten in Amerika lebt und arbeitet, zeichnet anhand vieler historischer Ereignisse und vor allem am Beispiel des jahrhundertealten Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung die Entwicklung des amerikanischen Selbstbildes nach und zeigt auf, warum die Amerikaner sich so schwer damit tun, sich den Anforderungen der Gegenwart zu stellen - auch unter Obama. »Der Mythos Amerika« ist eine kritische Bestandsaufnahme der Vereinigten Staaten - und zugleich ein geistiges Zeugnis für die Fähigkeit des Landes zur Selbstbesinnung und Selbstkorrektur.

Indianer als unzivilisierte Gegenwirklichkeit: Manfred Henningsen leuchtet den amerikanischen Mythos aus
Versteht denn niemand Amerika? Manfred Henningsens Studie "Der Fall Amerika" von 1974 schien auf diese These hinauszulaufen. Vor dem Hintergrund des Antiamerikanismus der siebziger Jahre beschrieb Henningsen den europäischen Blick auf die Vereinigten Staaten "als Sozial- und Bewußtseinsgeschichte einer Verdrängung", in deren Folge die Existenz des Landes bis ins 20. Jahrhundert "nicht als welthistorisches Ereignis eigener Art begriffen worden" sei. An den Amerikanern bemerkte er eine "mentale Abdichtung gegen die Erfahrungen des Elends und unverschuldeten Scheiterns", wie ein Epilog andeutete: "Die Verdrängung Hiobs charakterisiert das öffentliche Selbstverständnis des mehrheitlichen Amerikas." Mit "Der Mythos Amerika" hat Henningsen nun das damals gegebene Versprechen eingelöst und sich diesem Selbstbild, seinen Wurzeln und Wirkungen zugewandt.
Wesentlich für den Mythos ist die Blindheit gegenüber der Gewalt, die seit der Kolonialzeit die amerikanische Geschichte prägt. Den "Ursprung des neuzeitlichen Rassismus in Amerika" erkennt Henningsen im Bordbuch des Kolumbus. "Keiner von ihnen hat eine dunkle Hautfarbe", notierte Kolumbus über die Bewohner der Neuen Welt, die er für "schöne Menschen" hielt und damit von den Afrikanern abhob.
Krankheit und Krieg brachten den Untergang Alt-Amerikas, dessen Vergangenheit und Kultur den europäischen Vorstellungen von einer "Wildnis" zwar entgegenstanden, doch Entdeckung und Eroberung glichen die Wirklichkeit der Phantasie an. Die Kapitel zu Kolumbus und den Konquistadoren sind ein langer Anlauf, um die Nordung des Mythos schließlich auf die Ankunft der Puritaner in Nordamerika zu datieren, die alle nichtpuritanischen Anfänge der Neuen Welt ausgeblendet, die Indianer aber in den Mythos aufgenommen hätten - als "unzivilisierte Gegenwirklichkeit" zum "Schauspiel der puritanischen Zivilisation".
Die Sklaven seien hingegen "unsichtbar" geblieben, wobei Henningsen in der Verfassung ein Unbehagen der Gründerväter ausmacht, die es vermieden, die Sklaverei direkt zu erwähnen. Zwischen Freiheitsdenken und Sklaverei klaffte ein Widerspruch, den der freie Schwarze David Walker 1829 in einem radikalen Pamphlet angriff. Selbst seine Drohungen gegen die Weißen künden auf amerikanische Art noch von der Kraft der für unveräußerlich erklärten Rechte: "Versteht ihr eure eigene Sprache? Hört eurer Sprache zu - der Welt verkündet am 4. Juli 1776."
Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei verwehrte der Süden weiterhin vielen Schwarzen diese Rechte. An "mindestens 3200" Lynchmorden in den Jahren 1880 bis 1930 zeigt sich das Ausmaß der Gewalt, die weiße Südstaatler einsetzten, um ihre Vorherrschaft zu verteidigen. Henningsen nennt den Süden "eine im Vergleich zum kaiserlichen Deutschland und zur Weimarer Republik prononciert prägenozidale Gesellschaft".
Das Buch basiert weitgehend auf Beiträgen zu Zeitschriften und Sammelbänden, einige unveröffentlichte Abschnitte reichen auf Entwürfe aus den siebziger Jahren zurück. Als Aufsatzsammlung hätten die Texte in ihrer Zeitgebundenheit für sich stehen können, als Buchkapitel muten sie mitunter überholt an. Das Kapitel über Alt-Amerika vergleicht zwei Bände der "Fischer Weltgeschichte" von 1965 und 1971; der ältere soll belegen, "wie selbstverständlich europäische Historiker noch heute (sic!) die ideologischen Gemeinplätze der Eroberung verbreiten".
Seit 1970 lehrt der Autor Politische Wissenschaft an der Universität von Hawaii. Da Barack Obama in diesem multiethnischen Bundesstaat und in Indonesien aufwuchs, traut Henningsen ihm zu, die Beschränktheit des Mythos aufzuheben. "Er lebt bereits eine amerikanische Wirklichkeit, die nicht mehr vom amerikanischen Mythos gedeckt wird, sondern auf eine neue Symbolsprache wartet."
THORSTEN GRÄBE
Manfred Henningsen: "Der Mythos Amerika". Die andere Bibliothek. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2009. 357 S., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Selten sei das "Land der Freiheit" so deutlich als "Land der Völkermorde" dargestellt worden, schreibt Rezensent Rolf-Bernhard Essig. Dennoch sei dieses Buch weit davon entfernt, eine Lektüre für Amerikahasser zu sein. Denn undemagogisch zeichne der seit 1970 an der Universität Hawaii lehrende deutsch-amerikanische Politologe die amerikanischen Gründungsmythen und -lügen nach, samt der fatalen Folgen, die der Amerikanische Traum für Indianer und Schwarze hatte. Auch untersuche er Klischees der Sklaverei und des Rassismus bis ins 20. Jahrhundert, und biete "erhellende Daten aus der Forschungsgeschichte". Trotzdem sei das Buch nicht wirklich ein großer Wurf, merke man ihm doch sein Entstehen aus verschiedenen Essays des Autors an. Auch vermisst Essig die Frage nach dem Rassismus der Schwarzen ebenso, wie die Behandlung der Rolle der Latinos. Dann stören ihn viele Fremdwörter, die dem amerikanisierten Deutsch des Autors geschuldet seien.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH