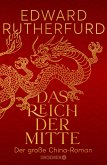Der ahnungslos entschlossene Held dieser Geschichte, ein gewisser Lerner, taumelt um die Jahrhundertwende in ein aberwitziges Unterfangen. Angestiftet und manipuliert von einer üppigen Hochstaplerin, der verwegenen Frau Neuhaus, reist er auf einem schrottreifen Dampfer in die Arktis, um eine herrenlose Insel zu annektieren.
Das liest sich, als wäre dieser Lerner ein entfernter Cousin von Felix Krull, und nicht weniger virtuos und komisch als der alte Meister entwickelt Martin Mosebach den Hintergrund seines Romans, ein wilhelminisches Gesellschafts-Panorama. In den Hauptrollen sehen wir den anrüchigen Kaufmann, den schnurrbärtigen Herzog-Regenten, die kleine Afrikanerin und den schäbigen Chefredakteur. Gut erfunden, also gelogen, könnte man meinen.
Aber nein! Unter dem Stichwort "Bäreninsel" schrieb einst "Meyers Konversationslexikon": "Im Auftrag eines Hamburger Syndikats nahm 1898 der Deutsche Theodor Lerner 85 qkm in Besitz, und 1899 hatte hier der Deutsche Seefischereiverein eine Station."
Eine wahre Geschichte also. Was wie ein höchst unwahrscheinliches Capriccio anmutet, ist ein absurdes Kapitel aus der deutschen Kolonialgeschichte. Der Traum von der Ausbeutung einer gottverlassenen Insel im Süden Spitzbergens führte zu diplomatischen Demarchen, und während Lerner auf den Eisschollen umherstolperte, wurden zwischen Berlin und Sankt Petersburg Depeschen gewechselt.
In einem halben Hundert kurzer Kapitel fächert Mosebach die Machenschaften seines Heldenpaares prismatisch auf und führt sie bravourös zu ihrem lachhaften Ende.
Das liest sich, als wäre dieser Lerner ein entfernter Cousin von Felix Krull, und nicht weniger virtuos und komisch als der alte Meister entwickelt Martin Mosebach den Hintergrund seines Romans, ein wilhelminisches Gesellschafts-Panorama. In den Hauptrollen sehen wir den anrüchigen Kaufmann, den schnurrbärtigen Herzog-Regenten, die kleine Afrikanerin und den schäbigen Chefredakteur. Gut erfunden, also gelogen, könnte man meinen.
Aber nein! Unter dem Stichwort "Bäreninsel" schrieb einst "Meyers Konversationslexikon": "Im Auftrag eines Hamburger Syndikats nahm 1898 der Deutsche Theodor Lerner 85 qkm in Besitz, und 1899 hatte hier der Deutsche Seefischereiverein eine Station."
Eine wahre Geschichte also. Was wie ein höchst unwahrscheinliches Capriccio anmutet, ist ein absurdes Kapitel aus der deutschen Kolonialgeschichte. Der Traum von der Ausbeutung einer gottverlassenen Insel im Süden Spitzbergens führte zu diplomatischen Demarchen, und während Lerner auf den Eisschollen umherstolperte, wurden zwischen Berlin und Sankt Petersburg Depeschen gewechselt.
In einem halben Hundert kurzer Kapitel fächert Mosebach die Machenschaften seines Heldenpaares prismatisch auf und führt sie bravourös zu ihrem lachhaften Ende.

Martin Mosebachs Eismeerfahrt / Von Tilman Spreckelsen
Was soll man von dieser Insel im Eismeer halten? Wer sie ansteuert, wie 1827 der Norweger Balthazar Keilhau, sucht schnell wieder das Weite und berichtet höchstens von unaufhörlichem Nebel, der die Reisenden mit seiner "dicken Feuchtigkeit" eingehüllt habe, von ungünstigen Landeverhältnissen, da die Insel keinen natürlichen Hafen besitze und den Schiffen keinen Schutz vor den Polarstürmen biete, von Moor- und Gesteinswüsten, schließlich von Bären- und Walroßskeletten, die, überzogen mit grünem Schimmel, überall auf dem Kiesboden herumlägen. Immer wieder erzählen zwar Seefahrer von einem leicht zugänglichen Kohlevorkommen auf der 1596 entdeckten Insel, aber zur Ausbeutung mag sich lange Zeit niemand entschließen. So wird das zwischen Tromsø und Spitzbergen gelegene Ödland ab und an von Fischern und Walroßjägern besucht, die nur dann länger bleiben, wenn sie den richtigen Zeitpunkt zum Ablegen verpaßt haben und auf der ringsum zugefrorenen Bäreninsel überwintern müssen.
Ein völlig trostloser Ort also. Um so erstaunlicher ist es, welchen Sog das Eiland mitunter auf jene ausübt, die es nur vom Hörensagen kennen. Auf Theodor Lerner etwa, einen Zeitungsvolontär im wilhelminischen Berlin, der nach einer verpatzten Reportage auf Rehabilitierung sinnt. Was, flüstert ihm eine dubiose Dame mittleren Alters ein, die ihm kurz zuvor buchstäblich vor die Droschke gelaufen war und für das Scheitern seines Auftrags verantwortlich ist, was, wenn Lerner die herrenlose Insel ansteuert, in Besitz nimmt und die sicherlich immensen Kohlevorräte abbaut? Oder besser noch: seine Insel an ein zahlungskräftiges Konsortium veräußert und als gemachter Mann nach Deutschland zurückkehrt?
So bricht Lerner unter dem Vorwand auf, einen verschollenen Arktisforscher zu suchen, betritt die Bäreninsel mit einem Bündel schwarzweißroter Grenzpfähle im Gepäck und steckt seinen Besitz ab. Daß von diesem Punkt an schiefgeht, was immer schiefgehen kann, liegt nur zum Teil an Lerners unbedarftem Wesen, das ihn zum Spielball und Aushängeschild eines großangelegten Schwindels werden läßt. Das Scheitern des kühnen Unternehmens, das Martin Mosebach seinem Roman "Der Nebelfürst" zugrunde legt, wurzelt vor allem in der Bereitschaft Lerners, sich von Gelesenem nur allzuschnell verzaubern zu lassen und die Lektüre umstandslos zum Sprungbrett ausgedehnter Pläne zu machen. Wie Mosebach diese Disposition abbildet, als Zeiterscheinung deutet und dabei gleichzeitig weit über die Epoche hinausweist, wie er dies am Beispiel und mit den Mitteln der wilhelminischen Massenliteratur unternimmt und sich doch nie in der Kolportage verstrickt, wie er fast beiläufig Züge der heutigen New Economy im Parabolspiegel ihrer hundert Jahre älteren Vorformen einfängt - all dies geschieht mit so beeindruckend leichter Hand, daß der Roman zu Mosebachs bislang bestem Werk geraten ist.
Deutschland im Jahr 1898: ein Kaiserreich, das seine erste große Finanzkrise überstanden hat und bei der Verteilung der Welt mitmischen will. Es ist die große Zeit der Illustrierten - "Gartenlaube", "Über Land und Meer" oder "Daheim", Zeitschriften, die ihre Schwerpunkte in bebilderten Reisereportagen und in Fortsetzungsromanen haben und deren Niedergang erst mit dem Siegeszug des Films einsetzen wird. Zudem ist die Jahrhundertwende die Zeit der literarisierten Edelgauner - Georges Manolescu, Journalist und selbsternannter "König der Hochstapler", veröffentlicht 1905 seine immens erfolgreichen Memoiren, und auch fiktive Trickser haben Konjunktur. Niemand verkörpert diese Inhalte und Formen - Reise, Fortsetzungsroman, Hochstapelei - besser als ein Erfolgsautor jener Zeit: Karl May.
Aus diesem Fundus bedient sich Mosebach gleich mehrfach: einmal auf der Ebene der Handlung, weil er seine Figuren tatsächlich auf Fernreisen schickt und in Hochstapeleien verwickelt, zum anderen in der Psychologisierung seiner Akteure, indem er ihre Beeinflussung durch die Illustrierten- und Zeitungslektüre deutlich macht.
Denn eigentlich handelt der Roman auf jeder Ebene von den Verheerungen, die Lektüre anzurichten vermag, von der letterngespeisten Sehnsucht nach der Ferne im besonderen, ein Verlangen, das mit den Mitteln der Literatur erzeugt und so manipuliert werden kann, daß selbst eine Bäreninsel zum Wunschziel wird. Die Zeitschriften mit ihren - oft mit viel Phantasie entworfenen - Illustrationen motivieren nicht nur zum Blick in die Ferne, sondern formen diesen Blick auch, indem sie, ob als Reportage oder als Roman, eine spezifische Exotik präsentieren, die nicht immer klar unterscheidet zwischen Sahara und Polarwüste. Das gilt auch für die Abbildungen. So mokiert sich einer, der es wissen muß, Lerners Chefredakteur Schoeps, über einen Fotografen: ",Bei Malkowski sieht der Nordpol aus wie die Sahara', sagte er abfällig und vergaß dabei, daß das bei vielen, ja den meisten Photographen so sein würde. Das gewellte Weiß von Schnee und Sand ähnelte sich gerade auf größere Distanz verflixt, da halfen nur geschickt ins Bild gebrachte Kamele oder Schlittenhunde bei der Zuordnung der Bilder." Eklektizistisch inszenierte Exotik führt der Roman auch außerhalb der Medien - aber deutlich durch sie beeinflußt - vor, etwa in Gestalt einer Varietédarbietung: Dressierte Eisbären teilen sich die Bühne mit einer farbigen Frau, die unbeweglich in einer Arktisdekoration verharrt. Auch Mosebachs liebevolle Beschreibung eines Frankfurter Fotografenateliers mit auswechselbaren Hintergründen zur Suggerierung unterschiedlicher Aufnahmeorte gehört in diesen Kontext der arrangierten Umgebung; selbst die Silhouette Frankfurts ist im Angebot.
Lerner selbst, der auch nach seinem Kurzbesuch keine empirisch erworbene Vorstellung von der Bäreninsel hat, aber vor potentiellen Käufern ständig über sie referieren muß, gerät in einen derartigen Sog des Erzählens und Ausschmückens, daß er darüber zum Dichter seiner Insel wird und sie ganz neu erfindet. So sinnt er einmal nach einem Vortrag seinen Worten nach und freut sich besonders an der Passage über die Pinguine - wo Sahara und Eiswüste zusammenfallen, sind auch Arktis und Antarktis austauschbar. Am Ende des Romans wird er sein Buch über die Insel schreiben: einen Reiseführer.
Die Presse bringt nicht nur die erfundene Ferne hervor, sie motiviert auch die Romanfiguren zu ihren Aktionen, und dies manchmal in erschreckender Konsequenz. So läßt sich etwa die eifrigste Leserin des Romans, Lerners dubiose Geschäftspartnerin Hanhaus, ausschließlich durch ihre allmorgendliche passionierte Zeitungslektüre zu ihren kleinen Lügen und großen Betrugsmanövern inspirieren. Stichworte genügen, und sie entwickelt vor den Augen des verdutzten Lerner atemberaubende Pläne, die ebenso dreist wie undurchführbar erscheinen und immer darauf hinauslaufen, Hoffnungen auf eine glänzende ökonomische Zukunft in ihren Geschäftspartnern hervorzurufen und mit ausgeklügelter Rhetorik so sehr zu verdichten, daß ihre Opfer tief in die Tasche greifen, um an dem erwarteten Gewinn teilzuhaben. Sie zeichnen Anteile am "Deutsche Bären-Insel-Unternehmen", einer flugs gegründeten und nur zum späteren Verkauf bestimmten Gesellschaft, die permanent Verluste macht, weil aus ihrem Vermögen der Lebensstil des Vorstands - Lerner, Frau Hanhaus und deren halbseidener Sohn Alexander - bestritten wird.
Eine dritte Übernahme aus dem wilhelminischen Zeitschriftenwesen kommt hinzu, ebenso geglückt wie die beiden anderen, aber mit noch weiter reichenden Folgen: Mosebach, dessen frühere Romane oft in glänzend ausgemalten Miniaturen schwelgten und darüber den Handlungsfaden schleifen ließen, hat sein Buch erkennbar nach dem Muster des Fortsetzungsromans gebildet. Das ist nicht nur eine hübsche Reminiszenz an die geschilderte Epoche, sondern verhilft dem Text auch zu einer Form, die es Mosebach erlaubt, seine Stärken im Episodischen auszuspielen, und die ihm gleichzeitig das Mittel zu einer größeren Kohärenz des Romanganzen fast wie von selbst in die Hand legt: Die zweiundvierzig kurzen Kapitel setzen jeweils mit der ruhigen Beschreibung eines neuen Schauplatzes oder einer neuen Perspektive ein, gewinnen allmählich an erzählerischer Rasanz und laufen auf eine überraschende Pointe zu, mit der das Kapitel abbricht - die klassische Struktur einer einzelnen Fortsetzungsromanlieferung, mit deren Hilfe die Spannung des Lesers bis zur nächsten Folge wachgehalten werden soll. Daß sich diese vielfach gebrochene Form mit ihren zahlreichen Schauplätzen, Gesellschaftsebenen und Milieus außerdem vorzüglich dazu eignet, ein Zeitpanorama zu erstellen, sei nur am Rande vermerkt.
Mosebach läuft bei aller Anverwandlung nie Gefahr, einen Illustriertenroman der Jahrhundertwende zu imitieren: dafür sorgen schon eine umfassend freundliche Ironie, mit der er seinen Helden begleitet, behutsame Verweise auf die Gegenwart und schließlich sein - vor allem durch die souveräne Beherrschung der Tempi - aufs schönste kalkulierter Stil. So meistert er eine schwere Aufgabe mit Bravour und Eleganz: Aus der öden Bäreninsel macht er einen funkelnden Ort der Literatur.
Martin Mosebach: "Der Nebelfürst". Roman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2001. 352 S., geb., 49,50 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ein begnadeter Stilist. Neue Zürcher Zeitung