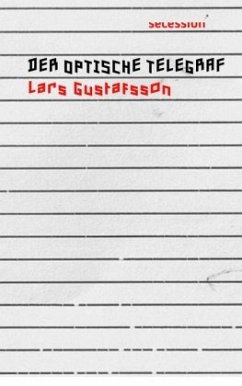Lars Gustafsson nimmt uns in seinem letzten, jetzt posthum erscheinenden Buch noch einmal mit auf eine Reise ins Grenzland zwischen Sprachphilosophie, Logik und Bedeutungstheorie, die an ihrem Ende zu letzten existenziellen Fragen führt. Gibt es Dinge jenseits des Sagbaren, über die wir nicht mehr sprechen können? Welche Bedeutung hat das Nichts? Was bedeutet es, nicht zu existieren? Hat das Sinnlose eine Bedeutung? Was ist Wahrheit, was Lüge, und worin unterscheiden sich beide? Existieren Träume oder nur Traum-Erzählungen? Ist jeder Träumer ein Dichter?Ausgehend vom Staunen über den seinerzeit rasend schnellen Kommunikationsweg des optischen Telegrafen kreisen die Gedanken des in gleicher Weise naturwissenschaftlich, philosophisch und literarisch versierten Universalgebildeten um die Möglichkeit, mathematische Strukturen für Sprache und Poesie mit bedeutungstheoretischen Ansätzen zu verbinden und fruchtbar zu machen. Es gelingt ihm dabei, linguistische und logisch-philosophischeProbleme nicht nur verständlich, sondern auch unterhaltsam darzustellen. Hier kehrt der große schwedische Autor zurück zu seinen Wurzeln, zu »Der Tod eines Bienenzüchters«, zu Wittgensteins Philosophie, den Schmerzen und der Endlichkeit.»Ich bin jetzt tot«, heißt es an einer Stelle dieses letzten Textes, um ein sprachliches Paradox zu veranschaulichen. Heute klingt dieser Satz wie ein schelmischer Ruf, der uns gleichwohl schmerzlich an seine Wirklichkeit erinnert. Da ist es ein Trost, dass Gustafsson in diesem Buch immer wieder auf die Leerstelle zurückkommt, auf das, was nicht mehr ist. Kann etwas oder jemand, das oder der abwesend ist, dennoch den Ton angeben? Dieses Buch zeigt, das genau das möglich ist.

"Der optische Telegraf": Letztes von Lars Gustafsson
Dies ist das letzte Buch, das der 2016 gestorbene Lars Gustafsson beendete. Nicht einer der großen deutschen Verlage brachte die kurzen Prosatexte heraus, sondern der Zürcher Secession Verlag, der das Abseits im Schilde führt. Es übersetzte die Berlinerin Barbara M. Karlson, mit Gustafssons Lyrik vertraut. Das Werk verlockt, vom kleinen Ende eines großen Autors zu sprechen. Aber das wäre bequem. Gustafsson schrieb immer schon kurze Prosa- und Lyrikbücher, und seine Autorschaft war stets heikel. Der Dichter und Philosoph empfing Beifall und Ehrung, wenn auch nicht den Nobelpreis. Gustafsson war ambitioniert und demütig zugleich. Er schwankte, ob er lieber ein Leibniz gewesen wäre oder "ein Stein am Grunde eines sehr alten Flusses". Erst der späte Autor sah keine Wahl mehr. "Schritte, die allerletzten Schritte, / hinaus ins Dunkel, sind schwer."
Dem Bereich der letzten Schritte entstammt wohl "Der optische Telegraf". Norberg - Stockholm 2013 bis 2015 werden als Daten der Entstehung genannt. Das Buch hat kaum persönlichen Gestus, liefert weder Bekenntnisse noch poetische Epiphanien. Hier spricht noch einmal der Philosoph, der Naturwissenschaftler und Linguist. Anders als Berufskollegen sucht Gustafsson nichts Neues. Er kommt zurück auf alte Themen und Vorlieben. Er ist, wie in seinen Anfängen, der retrograde Avantgardist. In seinem frühen Band "Die Maschinen" (deutsch 1967) heißt es: "Die uns auffallen, das sind Maschinen / aus einem fremden Jahrhundert; sie wirken ortlos. / Sie werden deutlich, nehmen Bedeutung an."
Genau dies lässt sich von dem optischen Telegrafen sagen, mit dem Gustafsson beginnt; er hat und überträgt Bedeutung. Er ist ein "Übertragungsmittel", eine linguistische Maschine. Dieser Telegraf des 19. Jahrhunderts konnte binnen zwei Minuten mittels Winkelmasten (Semaphoren) Nachrichten zwischen Berlin und Koblenz übermitteln. Unter den Exempeln nennt Gustafsson die fatale Niederlage der Südstaaten bei Gettysburg; man hatte versäumt, den dortigen Telegraph Hill zu besetzen.
So frappant dieses Fundstück ist, anderes ist bloße Häufung. An Überfülle leiden auch manche Themen und Aspekte mancher Kapitel des Buches. "Der zu große Anzug" etwa fragt etwa nach den vergrößerten Zeichensystemen, nach Nonsens und Metapher und ihrer Negation. Der Begriff Poesie wird erstaunlich weit gefasst. Gustafsson redet auch dort von ihr, wo es um Semaphoren oder Nonsens geht. Objet trouvé und Metapher sind dem semaphorischen Bereich gleich nah. So heißt es, fast provokant: "Metaphern werden nicht nur in der Poesie benutzt." So sah das 18. Jahrhundert Elektrizität quasi metaphorisch als eine Flüssigkeit; in den sogenannten Leidener Flaschen strömt die Energie zwischen den Polen. Generell gelten Gustafsson die Metaphern als Brücken zwischen Sprachschichten und Diskurssystemen. Damit nähert er sich auch wieder der Poesie.
Er tut das mit der berühmten Gedichtzeile: "Dezember. Schweden ist ein an Land gezogenes, abgetakeltes Schiff." Merkwürdigerweise erwähnt er nicht, dass dies eine Metapher des Freundes Tranströmer ist. Gustafsson hält die Metapher für kommunikabel. 1968, bei einem deutsch-schwedischen Literaturgespräch, wollte Peter Szondi in den miteinander verknüpften Begriffen "Schweden" und "abgetakeltes Schiff" ein "Drittes" erkennen, "für das es kein Wort gibt". Für Szondi ist das Dunkle die hermetische Poesie.
Gustafsson dagegen umkreist das Dunkle mit immer weiteren Begriffen - mit Negation, Gestik, Fragment und Imaginärer Semantik. Vielleicht tut er zu viel. Das mag manchen Leser ermüden. Womöglich auch Gustafsson selbst.
Gustafsson sucht sich einen Ausweg bei Nietzsche und Wittgenstein. In dem Nietzscheanisch geprägten Kapitel "Die Sprache und ihr Schatten" dominiert die Poesie, gibt es Glanz und Stimmung, Resignation und Triumph nebeneinander. Denunziatorisch werden Gedichte mit alten Imbissbuden verglichen, die mit der Zeit einen Affektionswert annehmen, "der kaum etwas damit zu tun hat, wofür sie stehen". Zum andern hält Gustafsson geradezu pathetisch an der Poesie als Utopie fest: "Die Poesie kann als eine Wachstumszone der Sprache genommen werden, eine Region, in der Sprache auf Sprache trifft und in den Metaphern neue Bildwelten geboren werden."
Schöner kann eine Apotheose der Poesie nicht gelingen, aber ist sie auch glaubhaft? Gustafsson hat seine Zweifel. Er holt sich dazu Wittgenstein zum Eideshelfer, nämlich dessen Geschichte vom Löwen: zwischen Löwe und Mensch gibt es keine Sprache. Dagegen setzt er die Suche nach einer Existenz "von jemand da draußen im Dunkeln". Doch auch diesen findet er nicht. Scheitern als Triumph! Mit solchen Aporien entlässt uns unser ratloser und unvergesslicher Lars Gustafsson.
HARALD HARTUNG
Lars Gustafsson:
"Der optische Telegraf".
Bedeuten und Verstehen.
Aus dem Schwedischen
von Barbara M. Karlson.
Secession Verlag für
Literatur, Zürich 2018.
125 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main