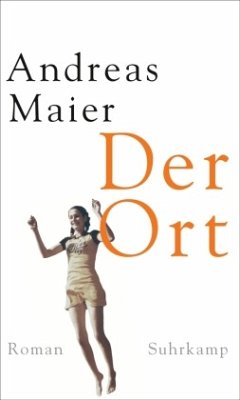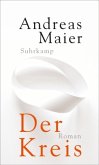Der Beginn der Liebe ist der Beginn der Macht. Die einen kommen in Frage, die anderen nicht. Selbst wenn sie, noch einmal wie Kinder, Gummitwist spielen, wissen sie doch bereits um ihre eigene Schönheit, denkt der Erzähler, der im Zimmer seines verstorbenen Onkels sitzt und an einer "Ortsumgehung" schreibt, während sie draußen die Landschaft planieren und ganz konkret eine Ortsumgehung bauen. Und in seiner Vorstellung geht er noch einmal einen Spaziergang, den er Jahrzehnte zuvor oft gegangen ist, als das Steinerne Kreuz noch nicht mitten im Ort, sondern noch draußen auf dem Feld mitten in der Wetterau stand. Und als die Mädchen Gummitwist spielten. Er erinnert sich an die Liebe zu Katja Melchior und an die erste Nacht mit dem Mädchen. "Alles war gut. Hätte man mich in diesem Augenblick getötet, wäre ich in einem vollkommen geheilten Zustand zum lieben Gott gekommen ..."

Andreas Maier setzt seine erzählerische Chronik der Wetterau fort: Im jüngsten Band "Der Ort" geht es um erste Liebe in den achtziger Jahren und den besonderen Moment, in dem Posieren beginnt.
Im Sport ist es verboten. In der Kunst nicht nur erlaubt, sondern längst zum beherrschenden Prinzip geworden: Eigenblutdoping. So nennt Diedrich Diederichsen das, wenn Künstler zur eigenen Biographie greifen, ihr Leben zur Kunst machen und ihrem Werk einen ordentlichen Schuss der eigenen Lebendigkeit verpassen. Der größte Eigenblutdopingfall der deutschen Literatur spielt sich derzeit in der hessischen Wetterau ab. Und der Haupttäter, Andreas Maier, macht aus seiner Praxis kein Geheimnis, sondern zählt seine Titel gleich als Erstes auf: "Der Ort, die Straße, das Haus, das Zimmer, neulich sagte ich mir, du nimmst jetzt alles, deine Heimat, die ganze Wetterau, deine Familie, deine Geschichte zwischen Grabsteinen und Steinbrüchen, setzt dich ins Zimmer deines Onkels und machst daraus dein letztes Werk, das du so lange weiterschreibst, bist du tot bist." So beginnt der vierte Band von Andreas Maiers wagemutigem Großromanprojekt "Ortsumgehung", von dem es heißt, es sei auf insgesamt elf Bände angelegt, obgleich der Autor seinerseits markiert, sich nur durch den Tod von diesem Werk scheiden zu lassen.
Dass Maier vom Jahr 2009 auf sein Leben zurückschaut, mag willkürlich erscheinen, folgt aber einer regionalen Logik: Im Herbst des Jahres wurde der Handlungsort Friedberg mit der titelgebenden Ortsumgehung beglückt, ein Mammutprojekt, Kostengigant und ein tiefer Einschnitt in die Physiognomie der ländlichen Region. Vielleicht sollte man darauf wetten, dass die letzten Sätze des Romanzyklus mit der Eröffnung der Straße zusammenfallen. Zumindest schwebt das Straßenprojekt wie ein Damoklesschwert über Maiers Wetterau-Chronik. Schon die Geburt der Umgehungsidee hat der Autor als einen Moment kollektiver Entgeisterung imaginiert. Jetzt beschwört "Der Ort" einen Schockmoment herauf, als der Protagonist, einer fixen Idee folgend, gezielt auf ein fahrendes Auto zuläuft. Kurz stockt einem der Atem, bevor man unwillkürlich in der Rolle des innerstädtischen Verkehrsberuhigers ausstößt: "Es braucht eine Ortsumgehung."
Um was geht es sonst in dem Roman? Um Pubertät, erste Liebe, Provinz, um das Sittenbild der frühen achtziger Jahre und den Beginn der Ära Helmut Kohl, die mit einem Festzeltbesuch eingeläutet wird. Vor allem aber geht es um ein zentrales Problem, das aufgetreten ist, seit das Leben des Künstlers zum Kunstwerk, die Biographie des Politikers zum Teil seiner Politik, die Privatsphäre des Managers zur Ingredienz seiner Strategie geworden ist, seit Eigenblutdoping zur kulturellen Technik geworden ist: Wenn man sich etwa wie Maier autobiographisch am eigenen Leib und Leben bedient, was zapft man eigentlich an, da das Leben vor lauter Selbstdarstellungszwang längst zum Authentizitätsspiel und zur Pose geworden ist. Maier gesteht: "Bis zum heutigen Tag und bis zu diesem Wort, das ich eben schreibe, weiß ich nicht, ob das alles Pose ist oder ob das alles ich bin."
Die Frage nach der Pose, als Ermächtigung seiner selbst einerseits, als Bedrohung des Wesenskerns andererseits, treibt den Erzähler nicht nur punktuell um. Aus dieser Frage entfaltet sich der gesamte Roman. Denn die Erinnerung sucht gezielt nach jenen Lebensmomenten, in denen das Posen ins Leben trat. Mit siebzehn, so erinnert sich der Erzähler, ist das Gefühl, das eigene Leben nur zu spielen, bereits komplett ausgereift. Von dieser Zeit berichten die eindrücklichen dreißig Seiten der Rahmenerzählung. Damals übt Andreas seine Posen anhand seiner Dostojewskij-, Hesse-, und Thomas-Mann-Lektüren ein. Das Nachäffen kanonischer Bildungsvehikel wird zum Alleinstellungsmerkmal. Noch in den eigenen vier Wänden spielt er sich selbst als einen anderen. Oder er streift, als verwilderter Melancholiker, verkleidet im Dostojewskij-Mäntelchen durch die Friedberger Straßen, um die Erinnerungsorte abzulaufen, die ihn an seine erste Liebe mit der Tochter des Buchhändlers erinnern. Zwei Jahre zuvor hatte er sich von ihr getrennt. Gefangen in seiner Gedankenwelt, entfremdet von seiner Gegenwart, inszeniert sich der Siebzehnjährige als Mnemotechniker, der seine Erinnerungen an affektbeladenen Orten ablegt, um sie beim Spaziergang wieder abzurufen: ein tägliches Stahlbad erinnerter Gefühle, das den Panzer des extravaganten Künstlers in spe undurchdringlich machen soll.
Wenn mit siebzehn das Rollenspiel schon zur Lebenskunst geronnen ist, wann fing es dann an? Mit dem Verlust der ersten großen Liebe, würde vielleicht die naheliegende Erklärung der Wirklichkeit lauten, und so mag das auch der junge Melancholiker gedacht haben, aber der Roman antwortet mit einem entschiedenen: Nein! Und genau darin liegt die große anthropologische These und erzählerische Pointe. Tatsächlich interessiert sich der Erzähler kein Fitzelchen für jenen Sommer der Gefühle, sondern umgeht die emphatischen Erinnerungsorte jener Zeit und erzählt stattdessen in vier Sequenzen von Ereignissen, die sich in den Monaten davor abspielten. Die Hauptrolle spielt daher auch nicht die namenlose Buchhändlertochter, sondern deren Freundin Katja Melchior. Die Geschichte des Romans besteht - so die Poetik der Ortsumgehung - in der Vorgeschichte. Denn dort tritt das Posen in das Leben des damals Fünfzehnjährigen ein. Die Liebe, so der provokante Schluss, ist schon Teil des Posierens, sie ist gespielte Liebe.
Mit welcher atmosphärischen Dichte, mit welcher beobachtenden Präzision Andreas Maier im Zuge von vier Episoden die Geburt des Posings aus der Pubertät schildert, ist große Erzählkunst. Ende Februar 1983 verlässt Andreas für eine Abendrunde noch einmal das Haus. Als er um die Ecke biegt, offenbart sich ihm ein faszinierender Anblick. Katja Melchior und drei Freundinnen spielen Gummitwist: "So etwas wie in der Schmidtstraße hatte ich noch nie gesehen. Die vier Mädchen tanzten im Gummiband, und immerfort lachten sie dazu mit klaren, erwachsenen Stimmen." Einerseits sind die Mädchen dem Spiel schon entwachsen, andererseits sind aber noch nicht so erwachsen, dass sie es nicht spielen würden: "Jetzt waren sie fast Frauen und spielten Kinder und waren noch keine Frauen und spielten dabei Frauen, die Kinder spielten. Im Grunde spielten sie sich selbst, es war ihnen bewusst, und dennoch ging dadurch nichts von der Anmut der Szene verloren."
Erst die Überlagerung von spielerischer Leichtigkeit und Pose schlägt den Erzähler in Bann. Der Bildmoment trägt alle Charakterzüge einer Epiphanie, bei der ein tastender Blick sich auf jenen Brennpunkt einstellt, an dem sich das wahre Wesen der Dinge offenbart. Das "wahre Wesen" allerdings besteht paradoxerweise in der Entzweiung, eben in der Pose, die die Mädchen einnehmen. Diese Eigenschaft teilen sie sich mit ihrem Betrachter. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit geschieht etwas, das Epiphaniker wie James Joyce oder Wilhelm Genazino nicht zu träumen gewagt hätten: Das Bild lässt den Erzähler in die Szenerie eintreten. Gemeinsam mit den Mädchen verbringt er den Abend in größter Vertrautheit und selbstverständlicher Selbstinszenierung. Drei weitere Ursprungsmomente schildert Maier in seinem Roman. Kurz danach findet eine Party statt, bei der sich Katja und Andreas vor den Augen der Freunde näherkommen. Nach einer ausgeklügelten Choreographie inszenieren sie das vermeintlich zufällige Geschehen, bis sie sich in einer Balance aus großem Theater und tiefem Empfinden endlich aneinander anlehnen. Für diese zärtlichste Entfremdung, seit es Heimatromane gibt, besänftigt Maier seinen spröden, widerspenstigen Erzählstil mit neuer Feinfühligkeit.
Hat die Inszenierung erst in das nachbarschaftliche Spiel, dann in die Theatralik der Party Einzug erhalten, so setzt es sich am Morgen danach im Umgang mit dem eigenen Körper fort, den Maier mit einer Apotheose der Rippunterhose beginnen lässt. In der letzten Episode komplettiert Maier seine Erzählstudie, indem er die Pose in die politische Sphäre eintreten lässt. Die Festzeltrede des neuen Parteivorsitzenden der CDU, während der die Grünen die fröhlich kiffende, lauthals pöbelnde Jugend mit Salatköpfen ausstattet, führt das politische Subjekt als Schauspieler auf öffentlicher Bühne vor. Ist auch die Bio-Politik von der Pose durchsetzt, kann jetzt die große Liebe kommen oder die Verwertung des eigenen Lebens als Kunst. Der Eigenblutdopingroman speist sich aus der paradoxalen Verschränkung von Authentizität und Pose. Wie soll man diese Romanart nennen? Poserprosa? "Der Ort" ist ein erzählerisches Kleinod, prägnant, analytisch scharf, liebevoll und gemein. Maiers große Ambition erhält Kontur. Noch lässt sich in den Romanzyklus gut einsteigen, langsam erscheint das unumgänglich.
CHRISTIAN METZ
Andreas Maier: "Der Ort". Roman.
Suhrkamp Verlag. Berlin 2015. 150 S. geb., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Die zärtlichste Entfremdung, seit es Heimatromane gibt.« Christian Metz Frankfurter Allgemeine Zeitung 20150812