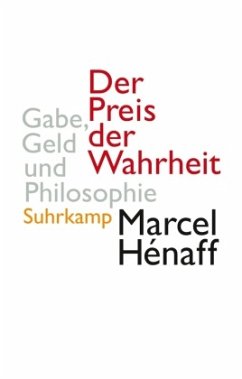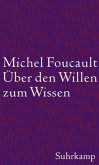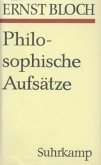Besteht eine Beziehung zwischen Wahrheit und Geld? Kann man von einem Preis der Wahrheit sprechen? Anders als die Sophisten, die einen Preis für ihre Lehren festsetzen, spricht Sokrates ohne Bezahlung. Doch nimmt er Geschenke an, die der von ihm angebotenen Gabe entsprechen. Er muß es sogar, wie Aristoteles versichert, weil Wissen und Geld kein gemeinsames Maß besitzen.Gibt es also Verbindlichkeiten, die sich keinem Vertrag verdanken, und Güter, die sich jedem Marktwert entziehen? Gibt es ein soziales Band diesseits von Gesetz und Geld? Marcel Hénaffs Studie zeigt, daß sich eine Antwort auf diese Fragen nur diesseits der eingespielten Arbeitsteilung zwischen ökonomischen und moralischen Diskursen finden läßt. Im Anschluß an die anthropologischen Forschungen von Marcel Mauss lokalisiert er die Quelle des Sozialen in dem elementaren Austausch von Gabe und Gegengabe.Doch was heißt »Geben«? Bedeutet es, »irgend etwas« anzubieten? Und woher kommt seine Kraft der Verbindlichkeit, warumfordert es dazu auf, die Gabe zu erwidern? Die anthropologische und ethnologische Forschung lehrt uns, daß die Antwort nicht mit Blick auf die gegebene Sache zu finden ist. Geben ist ein Akt der Anerkennung, der seinerseits Anerkennung fordert. Diese Einsicht entfaltet Hénaff am Phänomen des Opfers, der Schuld und der Gnade ebenso wie an den Strukturen des Geldverkehrs und des Marktes. In einer tour de force durch die europäische Geistesgeschichte analysiert er die religiösen und rechtlichen, die moralischen und ökonomischen Transformationen des Gabentauschs von Sokrates und den Sophisten bis in die Gegenwart.

Liebe und Freundschaft sind unbezahlbar: Marcel Hénaffs bewegende Verteidigung der Großzügigkeit
Geld regiert die Welt? Dieses Buch ist ein einziger Protest gegen die Auffassung von der grenzenlosen Tauschbarkeit von Werten und Lebenszielen in Geld. Es ist damit auch ein Protest gegen die "Hochfinanz", die - wie Hénaff in seinem übrigens schon 2002 auf Französisch erschienenen, nun von Eva Moldenhauer elegant übersetzten Buch schreibt - "unsere kulturelle Basis selbst in Mitleidenschaft gezogen" hat.
Marcel Hénaff hält sich an die harten Fragen, die beim Thema Geld aufkommen: warum man es in die Finger kriegen will und warum man von ihm die Finger lassen sollte. Die klügste Antwort auf die erste dieser Fragen findet sich immer noch in Georg Simmels "Philosophie des Geldes" aus dem Jahre 1900. Er "bricht", wie Hénaff anerkennt, mit der "langen Tradition des Argwohns", also mit dem Misstrauen, das die großen Denker und Dichter (Baudelaire: "Der Handel ist dem Wesen nach satanisch") dem Gelde entgegenbrachten. Die Vorzüge des Geldes liegen nicht einfach darin, dass es als Mittel zum Erwerb von Gütern taugt. Es hat höhere Verdienste. Unüberholt sind Simmels Einsichten in den Zusammenhang von Geld und Freiheit, in die Herauslösung aus ständischen Zwangslagen, die von Handels- und Tauschbeziehungen befördert wird, und in die Gleichheit, die sich zwischen Vertragspartnern auf dem Markt einspielt.
Hénaffs Resümee lautet dann: "Simmel hat das Bemühen um Rehabilitierung sehr weit getrieben. Zu weit, wird man sagen." Er will also das philosophische Misstrauen gegen das Geld nicht einfach aufgeben. Dieses Misstrauen stammt, wie Hénaff in Rückblenden auf eine von ihm wunderbar prägnant präsentierte Antike zeigt, keineswegs nur aus intellektueller Arroganz. Die Philosophie kann einfach nicht anders, als von Kindesbeinen an mit dem Geld zu hadern. Sie ist unter Schmerzen geboren: nämlich im Kampf gegen die Sophisten, die - wie Platon klagte - "Kenntnisse" verkaufen, ohne zu "wissen, was nützlich oder schädlich ist für die Seele". So ist die Auseinandersetzung mit dem Geld der Philosophie eigentlich angeboren, auch wenn sich heute viele Philosophen nur noch auf technische Finessen versteifen und von dieser Konstellation nichts mehr wissen wollen. Hénaff gibt den Philosophen die Erinnerung daran zurück und erhebt den Streit um den "Preis der Wahrheit" deshalb auch zum Titel seines Buches.
Das Hadern mit dem Geld ist aber nicht nur getrieben von der Selbstbehauptung der Philosophie. Hénaff dreht die Schraube weiter zu der These, dass die "Handelsbeziehung nicht in der Lage" sei, "die Menschen aneinander zu binden", sie also den "anthropologischen Grundlagen unserer Art und Weise, zusammen zu sein", nicht gerecht werde. Die großen Fragen der Schuld, der Vergebung, der Freundschaft, der Gunst, des Dankes, der Anerkennung - sie alle verlieren ihre Verankerung im Leben, wenn es nur noch darum geht, "positive oder negative Rechnungen" zu den Akten zu nehmen. Hénaff wird umgetrieben von der Frage, ob "die riesige Bewegung der modernen Wirtschaft - die ganze inzwischen weltweite Produktionsmaschine - am Ende die Idee dessen, was keinen Preis hat", ganz außer Kraft setze. Doch er will nicht nur mit erhobenem Zeigefinger dastehen, bis ihn ein Muskelkrampf ereilt. Er sucht im Alltag nach Handlungen und Haltungen, die sich gegen die "beängstigende Verführungskraft" des Geldes, gegen die totale "Verwechslung und Vertauschung aller Dinge" (Marx) sperren.
Zu den anregendsten Passagen seines Buches gehören jene Abschnitte, in denen Hénaff den Übergang von der griechischen Gunst als "menschlicher Großzügigkeit" zur christichen Gnade beschreibt. Wenn dann am Ende der Staat als gebende Instanz, als moderne Autorität die Nachfolge Gottes antritt, wird die "menschliche Großzügigkeit", die "interpersonelle" Dimension der Gabe, die Hénaff so kostbar ist, an den Rand gedrängt. Er verteidigt die Gabe als "Praxis der großzügigen Geste", die dem Anderen in seinem Anderssein zugewandt ist. Darin eben steht die Gabe im Widerspruch zu der Auffassung, dass alles seinen Preis habe: "Wir wissen, dass keine kaufmännische Gleichung den Preis des Lebens, der Freundschaft, der Liebe oder des Leidens wird ausdrücken können; oder den der Güter des gemeinsamen Gedächtnisses. Oder den der Wahrheit. Wir wissen, ohne es gelernt zu haben, dass nur eine Beziehung bedingungsloser Großzügigkeit sich diesem Bereich dessen, was keinen Preis hat, zu nähern vermag."
Goethe lässt sein Gretchen im "Faust" die Klage anstimmen: "Nach Golde drängt, / Am Golde hängt / Doch alles." Mit seinem Buch hat Hénaff getan, was er konnte - und er kann sehr viel -, um als Anti-Gretchen in die Geschichte einzugehen.
DIETER THOMÄ
Marcel Hénaff: "Der Preis der Wahrheit". Gabe, Geld und Philosophie. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Nachwort von Hans Joas. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009. 635 S., geb., 39,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Mit intellektuellem Vergnügen hat Rezensent Robin Celikates diese "gelehrte Abhandlung" zur Frage gelesen, ob es Dinge gibt, die nur einen Wert, aber keinen Preis haben können: die Wahrheit, die Kunst oder die Philosophie zum Beispiel. Marcel Henaffs zentrale These sei, dass es einen Bereich gebe, der von dem des "vermarktlichten Gütertausches strikt unterschieden werden" müsste, den Bereich des "symbolischen Gabentausches" nämlich. Der in den USA lehrende französische Literaturprofessor arbeite seine Diskussion entlang der Phänomene von Opfer, Gnade und Schuld aber auch an der Epochenwende der Erfindung des Geldes als Tauschwertersatz in drei Teilen heraus. Dem Rezensenten fehlt lediglich ein Ausblick dieser Grenzmarkierung der Marktlogik auf gegenwärtige Debatten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH