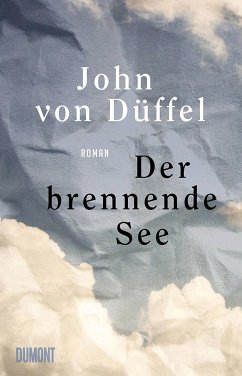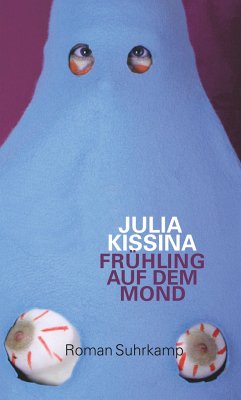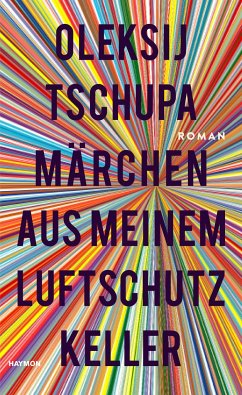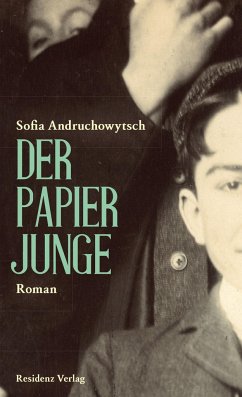Nicht lieferbar
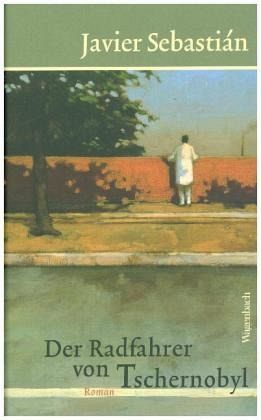
Der Radfahrer von Tschernobyl
Roman
Übersetzung: Lutter, Anja
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Alle vier Jahre tagt in Paris die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht. Doch für den spanischen Delegierten und namenlosen Erzähler diesesaußergewöhnlichen Romans nimmt die Konferenz eine unvorhersehbare Wendung: Den Standardkilostein als Eichmaß im Gepäck, wird er in einem Fastfood-Restaurant Zeuge davon, wie ein alter Mann ausgesetzt wird. Mehr oder weniger unfreiwillig nimmt er sich des Fremden an, auf dessen Unterarm eine geheimnisvolle Tätowierung in kyrillischen Buchstaben prangt. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Alten um den Atomphysiker Wassili Nester...
Alle vier Jahre tagt in Paris die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht. Doch für den spanischen Delegierten und namenlosen Erzähler diesesaußergewöhnlichen Romans nimmt die Konferenz eine unvorhersehbare Wendung: Den Standardkilostein als Eichmaß im Gepäck, wird er in einem Fastfood-Restaurant Zeuge davon, wie ein alter Mann ausgesetzt wird. Mehr oder weniger unfreiwillig nimmt er sich des Fremden an, auf dessen Unterarm eine geheimnisvolle Tätowierung in kyrillischen Buchstaben prangt. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Alten um den Atomphysiker Wassili Nesterenko handelt, dank dessen Intervention damals in Tschernobyl noch Schlimmeres verhindert werden konnte, verwischen sich die Grenzen zwischen Fiktion und Fakten vollends: Sebastián entführt uns aus Paris nach Prypjat, der Retortenstadt in unmittelbarer Nähe des Reaktors, und erzählt eindringlich die Schicksale seiner Bewohner. Sie verdanken Nesterenko - oder Wassja, wie der Radfahrer von Tschernobyl von ihnen liebevoll genannt wird - nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Zukunft: Unbeeindruckt von der staatlichen Repression tut Nesterenko alles dafür, den Opfern von Tschernobyl den Alltag nach der Katastrophe wenigstens ein bisschen zu erleichtern.