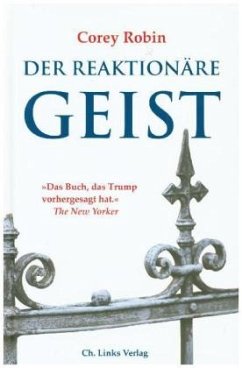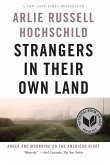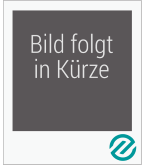"Eines der einflussreichsten politischen Bücher des letzten Jahrzehnts."
The Washington Monthly
Der Rechtspopulismus, für den US-Präsident Trump steht, wird meist vom klassischen Konservativismus unterschieden. Zu Unrecht, wie dieses Buch zeigt. Denn alles, was den Rechtspopulismus ausmacht, gehört zum grundlegenden Ideenbestand der Konservativen seit der Französischen Revolution. Europäische Intellektuelle haben das Fundament für die amerikanische Rechte gelegt, in deren Gedankenwelt der Anti-Intellektuelle Trump verankert ist. Anhand prägender Gestalten wie Edmund Burke - von Alexander Gauland gern zitiert -, Friedrich Nietzsche und Ayn Rand deckt Corey Robin die Kontinuitäten im konservativen Denken auf und stellt viele überraschende Verbindungen her. Ein kluges, elegant geschriebenes und provozierendes Buch.
The Washington Monthly
Der Rechtspopulismus, für den US-Präsident Trump steht, wird meist vom klassischen Konservativismus unterschieden. Zu Unrecht, wie dieses Buch zeigt. Denn alles, was den Rechtspopulismus ausmacht, gehört zum grundlegenden Ideenbestand der Konservativen seit der Französischen Revolution. Europäische Intellektuelle haben das Fundament für die amerikanische Rechte gelegt, in deren Gedankenwelt der Anti-Intellektuelle Trump verankert ist. Anhand prägender Gestalten wie Edmund Burke - von Alexander Gauland gern zitiert -, Friedrich Nietzsche und Ayn Rand deckt Corey Robin die Kontinuitäten im konservativen Denken auf und stellt viele überraschende Verbindungen her. Ein kluges, elegant geschriebenes und provozierendes Buch.

Corey Robins Buch über den reaktionären Geist zeigt den geistigen Sinkflug der amerikanischen Linken
Es gibt Bücher, die sind schlecht, regen aber immerhin zum Nachdenken an, und es gibt Bücher, die einfach nur schlecht sind. Das vorliegende Werk zählt zur letzteren Kategorie. Wenn es in irgendeiner Weise für die intellektuelle Situation der amerikanischen Linken kennzeichnend sein sollte, dann befindet sich diese in einem geistigen Sinkflug, der sich mehr an den Twitterorgien des regierenden Präsidenten als an den theoretischen und methodischen Diskussionen der progressiv-kritischen Traditionen des Landes orientiert. Corey Robins Buch ist ärgerlich, weil es gar zu simpel, gar zu uninformiert und gar zu wenig reflexiv angelegt ist.
Gewiss, aus der Perspektive eines echten Linken sind Konservative, Reaktionäre, Traditionalisten, Rechtspopulisten und Faschisten hochproblematische Figuren. Das ist in sich verständlich und nachvollziehbar, bis zu einem gewissen Grad eine notwendige Folge emanzipatorischen Denkens. Aber noch der einfältigste Progressive sollte sich doch zumindest ansatzweise um Nuancierungen und Differenzierungen bemühen und einen Hauch von Verständnis für Argumentationen beziehungsweise explizite und implizite anthropologische Vorannahmen haben, die dann eine konservative oder reaktionäre politische Haltung nahelegen. Robin erspart sich all diese Feinheiten und wirft schon vorab jede Unterscheidung über Bord.
Für ihn sind Konservative und Reaktionäre, Traditionalisten und Faschisten, Rechtspopulisten und alle anderen Varianten nichtprogressiven Denkens unterschiedslos eins. Sie repräsentieren ein rein reaktives Gespenst "von oben", das als Nachhut patriarchal-hierarchischer, auf Ausbeutung, Rassismus, ökonomischer Unterdrückung und militanten Bellizismus gegründeter Systeme immer dann sein Unwesen treibt, wenn die progressiv-emanzipatorischen Kräfte "von unten" den offenbar notwendigen Weg des Fortschritts vorangehen. Diese simple Dichotomie von Gut und Böse durchzieht jede Seite von Robins vorgeblicher Ideengeschichte. Es ist ein wenig, als würde ein Konservativer eine Ideengeschichte der Linken schreiben, in der Stalinisten, Trotzkisten, Maoisten, Anarchisten, Sozialdemokraten, Grüne und Liberale nur ein Ziel haben: den Totalitarismus.
Hier wie dort fehlt jedes Gespür für notorische Ambiguitäten in der Geschichte. Warum etwa ging in den Vereinigten Staaten die Durchsetzung des demokratischen Wahlrechts zumindest für alle freien weißen Männer im frühen neunzehnten Jahrhundert durchweg mit der rassistisch motivierten Entrechtung freier, grundbesitzender Schwarzer einher? Oder warum waren so viele emanzipatorische Abolitionisten ähnlich vorurteilsbeladen wie südstaatliche Sklavenhalter? Hier war offenkundig der Fortschritt selbst rassistisch. Ähnliches gilt für die unsäglich antisemitischen und antischwarzen Äußerungen von Karl Marx über Ferdinand Lassalle. Mehr noch: Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert waren es Konservative, wie Friedrich von Gentz, Constantin Frantz und selbst der Fürst Metternich, die für eine - in der Tat antirevolutionäre, aber eben auch antibellizistische - föderalistische Friedensordnung in Europa eintraten.
Sie alle machten die Kriegspolitik der überkommenen Fürstenwelt der Spätaufklärung für die blutigen Folgen der Französischen Revolution, die sie zu Beginn voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft begrüßt hatten, und der "fortschrittlichen" Napoleonischen Angriffskriege mit ihren Hekatomben von Opfern verantwortlich. Selbst der Hochimperialismus mit seinem liberal-kapitalistischen Rassismus fand immer auch konservative und eben nicht nur sozialistische oder linksliberale Kritiker. Robin erwähnt sie sämtlich entweder überhaupt nicht oder wischt ihre Kritik am Ancien Régime und seiner Kriegspolitik als bedeutungslos vom Tisch.
Schließlich mangelt es ihm an einer sauberen Analyse der konservativen und katholischen Kapitalismuskritik im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert. Iring Fetscher, ganz sicher kein Konservativer, hat einmal bemerkt, die Konservativen des neunzehnten Jahrhunderts hätten ein sehr viel feineres Gespür für die soziale Frage gehabt als die "Herren des Fortschritts". Nur ihre Antworten seien halt falsch gewesen. Und die "roten Kapläne" zur Zeit des "Großen Ruhrarbeiterstreiks" von 1889 standen in einer ultramontanen Tradition, als sie oder der intellektuelle Vordenker der katholischen Sozialehre, der Jesuit Heinrich Pesch, von den Kapitalisten als "blutsaugenden Vampyren" sprachen.
Man fragt sich zudem, warum beispielsweise zutiefst reaktionäre Päpste wie Gregor XVI. und Pius IX. den Traditionalismus eines de Maistre wegen seines antiintellektuellen Fideismus ebenso verurteilt haben wie später Pius XI. Charles Maurras und die rechtsextreme Action Française in den 1920er Jahren? All dies kommt in Corey Robins Buch nicht vor, weil es die schöne Einfachheit der dogmatischen Grundthese stören und zum neuerlichen Nachdenken zwingen würde.
Das Schlimme ist, dass Robin die vielfältigen Diskussionen um eine adäquate Definition konservativer und anderer rechter Phänomene, darüber, ob es sich um situative, relationale oder fixe, überhistorische Denksysteme handelt, kennt. Aber er verweigert sich schlicht dem Diskurs, ohne freilich irgendetwas anbieten zu können, das interpretativ weiterhelfen würde. Ein Grundfehler seines Ansatzes liegt in der problematischen Gleichsetzung von angelsächsischem, zuvörderst amerikanischem conservatism und europäischem Konservatismus. Ersterer verteidigt immerhin die von ihm als Errungenschaften verstandenen Ergebnisse der amerikanischen Revolution, der selbst der Vater der Tories in Großbritannien, Edmund Burke, durchaus Positives abzugewinnen vermochte.
Gleichzeitig huldigt er, neben seinem inhärenten Traditionalismus, einem individualistischen, libertär anmutenden Freiheitsbegriff, der - und da hat Robin vollkommen recht - oft einzig dazu dient, die liberale Klassengesellschaft zu rechtfertigen. Demgegenüber sieht sich Letzterer in der Opposition zu den Idealen des Terrors in der Französischen Revolution, ist staatsorientierter und ordnungspolitisch gerade nicht libertär oder wirtschaftsliberal. Der "Manchesterliberale" war der Erzfeind des kontinentaleuropäischen Konservativen. Da hilft es dann auch nicht weiter, locker eine Zettelsammlung von Zitaten, die nie in den historischen Kontext gerückt werden, über die Buchseiten zu verteilen.
Besonders übel wird Robins artifizieller Einheitsbrei dort, wo er sich selbst originelle Denkanstöße verbaut. So hätte man gerne Tiefschürfenderes über die repressiven und patriarchalischen Strukturen konservativen oder reaktionären Familiendenkens erfahren sowie über deren mannigfaltige Wechselwirkungen mit sozial- und wirtschaftspolitischen Anliegen. Auch der Zusammenhang des Denkens von Nietzsche mit dem gegenwärtigen Neoliberalismus, den Robin konstatiert, hätte weitere Reflexionen gelohnt. Dann aber hätte man auch über die ökonomisch-theoretischen Schwachstellen des nietzscheanischen Dekonstruktivismus und seiner anhaltenden Unfähigkeit, dem Neoliberalismus ein tragfähiges, kritisches Konzept entgegenzustellen, diskutieren müssen.
Das aber war offenkundig nicht gewollt. Und dies führt am Ende dazu, dass das Buch uns nicht wirklich etwas zum Aufstieg Donald Trumps und des sogenannten Rechtspopulismus zu sagen hat. Wenn alle Katzen "der Rechten" gespensterhaft grau sind, kann man auf präzise historische Verortungen und konkrete politische Bestandsaufnahmen offenbar getrost verzichten.
MICHAEL HOCHGESCHWENDER
Corey Robin:
"Der reaktionäre Geist".
Aus dem Englischen von
Bernadette Ott.
Christoph Links Verlag,
Berlin 2018.
344 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Eines der einflussreicheren politischen Bücher des letzten Jahrzehnts." The Washington Monthly "Das Buch, das Trump vorhergesagt hat." The New Yorker "Ein äußerst lesenswerter Parforceritt durch die Sünden des Konservativismus." The Observer "Wir haben unsere Redakteure gefragt, was sie zuletzt gelesen haben ... Wir empfehlen u. a. Corey Robins DER REAKTIONÄRE GEIST." n+1 "Eine originelle, gebildete und meinungsstarke Darstellung einer der maßgeblichen Bewegungen unserer Zeit." Times Higher Education "Meiner Meinung nach hat Corey Robin [den Konservativismus] am besten auf den Punkt gebracht: Es geht um den Erhalt von Hierarchien." Paul Krugman, New York Times "Ein bahnbrechendes Buch ..." Rolling Stone