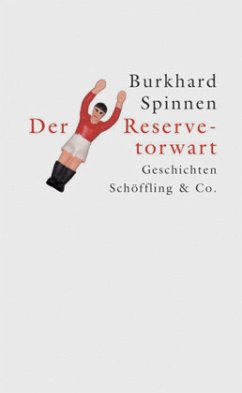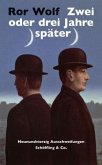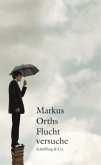Ein Fußballprofi findet sich damit ab, nur Reserve zu sein. Ein verheirateter Mann simuliert den Ehebruch, ein Rockfan sucht halbherzig sein altes Idol. Und ein zu allem entschlossener Tyrannenmörder wartet noch auf ein angemessenes Opfer.Burkhard Spinnens Helden sind Männer, die sich mit dem Mittleren arrangiert haben: mit mittleren Laufbahnen, mittlerem Erfolg, mittleren Malaisen und mittlerem Alter. Aber nur einen Schritt beiseite getreten, erscheint das mittlere Maß als das Mittelmaß; das heißt: als etwas vollkommen Unerträgliches. Und so drohen eine kleine Aufregung, ein überraschender Jahrestag oder eine harmlose Notlüge gleich furchtbare Katastrophen anzurichten. Der Mittelweg ist und bleibt der gefährlichste.

Burkhard Spinnens neue Erzählungen / Von Thomas Wagner
Am fünfzigsten Geburtstag des Direktors rettet der zweite Mann im Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens dessen zwei Jahre altem Sohn das Leben, ohne daß jemand es bemerkt. Wenig später schleudert er eine Uhr - ein Erbstück, das der Direktor von dem Eigentümer der Firma geschenkt bekommt - aus dem Fenster und wird entlassen. Ein leitender Ingenieur beginnt nach dem Verlust eines Kindes und dem späteren Tod seiner Frau die Leere seines Daseins mit einer Modelleisenbahn auszufüllen. Was sich im Lauf der Jahre welthistorisch auch ereignet, nichts vermag in die von ihm gesteuerte Modellwelt einzudringen. Ein Mann stellt fest, daß er sich mit Aids infiziert hat, will alles hinter sich lassen und zu einer Weltreise aufbrechen, gerät aber in die Fänge von Medizinern, die ihn, als sie herausfinden, daß er als einziger gegen die Krankheit immun ist, nicht wieder in die Freiheit entlassen wollen.
Die Infekte, von denen Burkhard Spinnen schreibt, sind selten Krankheiten zum Tode. Und doch raubt die Malaise, um die es hier geht, seinen Protagonisten die Möglichkeit zu leben. Ein Entrinnen ist unmöglich. Alles steht auf der Kippe. Und keine Figur weiß, wie sie mit dem plötzlichen Verlust an Verläßlichkeit zurechtkommen soll, den ihre kleine Bürgerwelt erleidet. "Blut an den Händen", sagt Miriam, Teilnehmerin an einem Kochkurs in der Geschichte "Ente Orange", "ist kein Problem. Aber nicht an meiner besten Bluse!"
So sind sie, Spinnens Weltkleinbürger - leidensbereit, aber gefühlsarm, sentimental, aber verantwortungslos. Vor allem aufstrebende und doch hilflose Männer läßt der Autor auf schmalem Grat balancieren und abstürzen. Eben noch schlenderten sie beschwingt und voller Zuversicht durch die gepflegten Vorgärten ihres Alltags, da ist mit einem Mal und von jetzt auf gleich Schluß mit der Illusion, alles laufe normal. Ihre kleine Welt hat plötzlich ein großes Loch, durch das all der mühsam zusammengeklaubte Sinn ihres Daseins sturzbachartig und unwiederbringlich abfließt. Aber nur ausnahmsweise steigert sich das Unglück zur Tragödie wie in der beklemmenden Geschichte mit dem schlichten Titel "Vater". Meist fallen Sicherheit und Gewohnheit einfach in sich zusammen wie ein Kartenhaus, ohne daß einer der Betroffenen wüßte, wie er darauf reagieren sollte. Große Gefühle sind nicht vorgesehen. Keiner weiß, wohin mit ihnen und wie mit ihnen leben. Also erfolgt die Entladung mit Verzögerung, übersprungsartig und nicht selten absonderlich. Derart überraschend und heftig tritt die Ruptur der bürgerlichen Welt ein, daß nur Wahn, Selbstmord und Aberwitz Linderung versprechen, Lösungen, auf die man sich freilich nicht versteht.
Das Auffällige an Spinnens Prosa ist ihre Ökonomie. Behende springt er mitten ins Geschehen; schnell und präzise spannt er die Koordinaten einer Geschichte auf. "Niemals hatte sich Schürings vorstellen können, einmal Witwer zu sein"; "Am Morgen wurde Kortschläger entlassen"; "Bei einem Autounfall, den sie nicht verschuldet hatten, kamen seine beiden Eltern ums Leben" - so oder ähnlich beginnen alle vierundzwanzig Erzählungen. Und doch findet sich keiner, als er am Morgen aus unruhigen Träumen erwacht, in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt.
Wo das kleine Glück zusammenstürzt, gibt der Autor selbst den Äquilibristen, der seine Plots so souverän konstruiert, daß man bereits nach der Lektüre einer Handvoll Erzählungen beginnt, den kurzen Sätzen in der Erwartung zu folgen, was das hübsch zusammengezimmerte Lebensgebäude denn wohl diesmal zum Einsturz bringen würde. Denn wo das Dasein strauchelt, aus dem Tritt gerät und fällt, wo sich das Blatt unerwartet wendet, bleibt Spinnens Sprache glatt und deren Oberfläche gespannt wie ein Bergsee bei Windstille. Was zählt, ist das Ereignis, dem die Protagonisten, als wünschten sie sich in eine Zentrifuge, zu entfliehen suchen. Nicht auf eine novellenhafte Wendung steuert das Erzählen zu; selbst dann nicht, wenn das alles umstülpende Ereignis nicht vor, sondern innerhalb der Erzählung liegt. Steil wie eine Parabel läßt Spinnen die Spannungskurve seiner Prosa ansteigen, um sie kurz über dem Zenith und vor der Verdichtung zum Gleichnishaften abzubrechen - und in einer Zweideutigkeit ausklingen zu lassen, die manchmal so etwas wie den Schein von Normalität wiederherstellt. Und wenn doch einmal Neues zu sprießen beginnt, so schmerzen dessen Wurzeln ebenso wie bei Fribeck, einem Mann mit Glatze, die Haare, mit deren Verlust er sich längst arrangiert hatte und die nun unangenehm borstig nachzuwachsen beginnen.
Spinnen ist ein kühler Experimentator, der all seine Grüters und Schürings, seine Kortschlägers und Hastenraths ohne Vorwarnung wie Schachfiguren in aussichtslose Endspiele hineinwirft, um sich auszudenken und beobachten zu können, wie sie auf die abrupte Wendung ihres Lebens ins Katastrophische reagieren, welche Lösung sie in einer Situation parat haben, für die es keine gibt. Oder eben nur eine schizoide, die es ihnen erlaubt, wenigstens in ruhigere Zonen zurückzukehren. Spinnen tut dies nicht, um sich an ihrem Versagen zu weiden oder sich über ihre Entgleisungen und Absonderlichkeiten zu erheben, sondern um am Irrsinn des Unabwendbaren das Aberwitzige einer Normalität sichtbar werden zu lassen, die sich wie eine dünne Haut auf dem Schicksalhaften gebildet hat und jederzeit aufreißen kann.
Spinnen ist der Präparator abgründiger Konstellationen. Selten tragen seine Figuren dabei ihre psychische Disposition zur Schau, niemals aber sucht der Autor nach Motiven oder gar Erklärungen. Immerhin beint da einer mal nicht nur die eigenen Erlebnisse aus, bis nur Allerweltsgefühle bleiben, die in einer larmoyanten Allerweltssprache ausgewalzt werden, als gelte es ein paar literarische Knöchelchen zu arrangieren. Und doch erscheint eine solch artistische Manier, mit dem Schicksal zu jonglieren, in einer Welt ohne Transzendenz und Metaphysik eigentümlich leer. Man darf staunen oder erschrecken, wirklich berührt ist man nie. Spinnen ist kein T. C. Boyle, der liebevoll, aber genüßlich das Spießbürgerliche mit dem Skalpell der Ironie seziert wie einen Kadaver. Es gelingt ihm auch nicht, den Leser an seine ängstlichen Verlierer zu fesseln wie Patricia Highsmith, in deren Geschichten man stets weiß, daß längst alles ins Rutschen geraten ist, aber gleichwohl hofft, die Katastrophe würde sich doch noch abwenden lassen.
So ist Spinnen ein Moralist ohne Moral, der uns auf eine blankpolierte, funkelnde Prosa-Rutschbahn setzt, die wir in Windeseile hinuntersausen. Dann reiben wir uns die Augen, die nur vom literarischen Fahrtwind etwas tränen. Es ergeht uns mit diesen Geschichten wie Miriam, die im Kochkurs Bluse und Gefühl fleckenrein halten will: "Sie griff in die Ente, dann schrie sie leise. In einem durchsichtigen Plastikbeutel lagen die Innereien sauber übereinander. Miriam schüttelte den Kopf. ,Traumhaft', sagte sie, dann sah sie Kortschläger an.'"
Burkhard Spinnen: "Der Reservetorwart. Erzählungen. Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2004. 216 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Thomas Wagner vergibt gute Note an diese Erzählungen, in denen er eigenem Bekunden zufolge lauter "Weltkleinbürgern", vor allem aufstrebenden und doch hilflosen Männern begegnet ist: "leidensbereit, aber gefühlsarm". Die Plots der Erzählungen findet er so souverän konstruiert, dass er sich stets aufs neue fragt, wie Spinnen diesmal das "Lebensgebäude" seines Protagonisten zum Einsturz bringen werde. Das hat natürlich auch etwas von Laborversuchen: Immer wieder beobachtet Spinnen, wie seine Protagonisten auf drohende Katastrophen reagieren. Sie agieren dabei in einer Welt ohne Transparenz, Moral oder Metaphysik. Wagner fröstelt ein wenig angesichts dieser Leere.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Eine taktische Meisterleistung. Keine der zwei Dutzend Geschichten scheitert. Manche erheitert, manche fasziniert, manche patzt ein wenig, eine ist umwerfend. Bei jeder lohnt sich das Lesen, bei jeder das aufmerksame Zuschauen." Frankfurter Rundschau