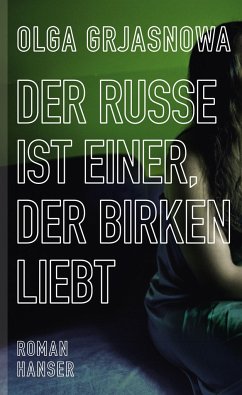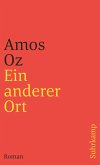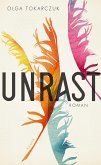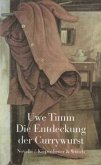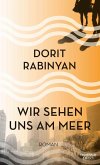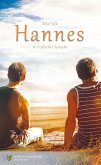Mascha ist jung und eigenwillig, sie ist Aserbaidschanerin, Jüdin, und wenn nötig auch Türkin und Französin. Als Immigrantin musste sie in Deutschland früh die Erfahrung der Sprachlosigkeit machen. Nun spricht sie fünf Sprachen fließend und ein paar weitere so "wie die Ballermann-Touristen Deutsch". Sie plant gerade ihre Karriere bei der UNO, als ihr Freund Elias schwer krank wird. Verzweifelt flieht sie nach Israel und wird schließlich von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. Mit perfekter Ausgewogenheit von Tragik und Komik und mit einem bemerkenswerten Sinn für das Wesentliche erzählt Olga Grjasnowa die Geschichte einer Generation, die keine Grenzen kennt, aber auch keine Heimat hat.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Hohe Anerkennung zollt Cristina Nord diesem Romandebüt von Olga Grjasnowa, Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. "Der Russe ist einer, der Birken liebt" erzählt die Geschichte einer Familie aus dem aserbaidschanischen Baku, die Mitte der 1990er Jahre in eine deutsche Kleinstadt zieht. Im Mittelpunkt sieht Nord die am Anfang etwa zwölf Jahre alte Tochter. Der Roman vermittelt für sie anschaulich, was es heißt als Einwanderer in Deutschland zu leben, wie es ist, die Eltern aufs Ausländeramt zu begleiten, dolmetschen zu müssen, in der Schule zurückgestuft zu werden und immer wieder rassistischen Äußerungen ausgesetzt zu sein. Sie hebt den lakonischen Stil der Autorin und die Nüchternheit der Schilderungen hervor. Das Fazit der Rezensentin: eine eindrucksvolle Innensicht vom Leben in einer Einwanderungsgesellschaft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Olga Grjasnowa erzählt in ihrem mitreißenden Debüt "Der Russe ist einer, der Birken liebt" von einer wütenden jungen Heldin. Mascha ist eine Ausnahme, aber kein Einzelfall.
Selten wurden Kriege über Jahrhunderte hinweg so erbittert und grausam geführt wie im Kaukasus - wir haben die schrecklichen Bilder von halbverhungerten Menschen im Schnee der Ruinenstadt Grosny und die zerlumpten, verstümmelten Flüchtlinge aus Bergkarabach noch vor Augen. Aus dieser traumatisierten Gegend, in der bis heute der Ausnahmezustand herrscht, stammt Olga Grjasnowa, die in ihrem mitreißenden Debüt "Der Russe ist einer, der Birken liebt" von ihrem Alter Ego Mascha Kogan erzählt, die, wie sie selbst, 1996 als jüdischer Kontingentflüchtling aus Baku nach Deutschland kam. Die Alternative wäre Israel gewesen, vor dem die Familie sich der Gewalt wegen fürchtete. Also blieb Deutschland, in dem "die Asche noch warm" war, wie ihre Mutter bitter formulierte - die Großmutter war eine Holocaust-Überlebende.
Als die 1983 geborene Autorin im wörtlichen Sinne sprachlos hier ankam, war sie nach Pogromen und Flucht längst kein Kind mehr. Auch ihre Heldin Mascha trägt diese Erinnerungen mit sich, sie haben sich ihrem Körper eingeprägt. Und in Momenten der Angst oder der Erschöpfung genügen eine bestimmte Art von Stille oder eine bestimmte Farbe, um sie in die Stunden des Pogroms zurückzuversetzen. Ein bedrohlicher Mechanismus, den Olga Grjasnowa einfühlsam und genau beschreibt und der wie ein vergessener Bumerang genau in dem Moment zurückkehrt, in dem Mascha glaubte, durch die Liebe erstmals wirklich in Deutschland angekommen zu sein.
Die Demütigungen der ersten Jahre im fremden Land, die anfängliche Sprachlosigkeit und die Verachtung der Lehrer hatten ihr nichts anhaben können. Von brennender Ungeduld und wütendem Ehrgeiz getrieben, lernt sie wie eine Besessene und beherrscht als Studentin nicht nur Deutsch, sondern vier weitere Sprachen perfekt, hat Praktika in Brüssel, Wien und Warschau gemacht und steuert eine Karriere bei den Vereinten Nationen an. Mit Liebe hält sie sich nicht groß auf, jagt von einem Sex zum nächsten und ärgert sich schon, wenn ein Mann wieder anruft. Bis sie, zu Hause in Frankfurt, Elias kennenlernt und völlig überrascht wird von der Ruhe, die plötzlich in ihr Leben einkehrt - anfangs gegen ihren heftigen Widerstand. Denn "zu Hause", das war immer ein furchterregender, von Gewalt erfüllter Ort für sie.
Mascha ist eine eindringliche, starke Figur, ein neuer Typus in der deutschen Gegenwartsliteratur: diese leistungsbereite, weltgewandte und bissige junge Frau würde Thilo Sarrazin das Fürchten lehren. Durch ihre Augen sehen wir ein tumbes, unfreundliches Deutschland, voller Unverständnis, Ressentiments und hysterischer Fremdenangst, auf das man nur, wie Mascha, mit bösem Witz reagieren kann. Genauso auf die Nerven geht ihr die freundliche Ignoranz ihres Professors, eines Multikulti-Gutmenschen, der nicht versteht, dass man auch ohne fließendes Wasser gut Klavier spielen und einen Privatlehrer für Französisch haben konnte, wie sie in Aserbeidschan. Doch machen die entwurzelten und traurigen Exilanten und Flüchtlinge ringsum sie auch sprach- und ratlos, jeder scheint seinen eigenen, skurrilen und einsamen Kampf zu führen.
Dieses Panoptikum wirkt manchmal überpointiert, auch dass Elias aus einer gewalttätigen, im Alkoholismus versunkenen Ost-Familie stammt, ist eine Katastrophe zu viel, eine Schwachstelle des Romans, mit der aber sein Humor wieder versöhnt. "Vielleicht hatte er den eigenen Sexismus dekonstruiert und dachte, er könnte sich nun alles erlauben", denkt Mascha nach einer unverschämten Attacke in der Unibibliothek und lacht so herzhaft, dass der Widerling sie erschrocken anstarrt. Wenig Zeit bleibt dem Liebespaar, und es sind nur einzelne, zart und leicht erzählte Momente gelungener Nähe, die beide ihren Ängsten und ihrem inneren Panzer abtrotzen können. Die tiefe Zuneigung, die sich fast nur in kleinen, alltäglichen Gesten äußert und erst im Nachhinein ihr tragisches Gewicht offenbart, ist das vorsichtige, gelungene Hoffnungsbild des Romans. Als Elias sich schwer verletzt, versucht Mascha in einer anrührenden Szene mit Gott zu handeln und bringt ihm ein kindlich-schreckliches Hasenopfer auf dem Mittelstreifen einer Schnellstraße. Erst nach Elias' Tod findet sie in seinen Papieren ihre große Angst widerlegt, er habe sie zu schwierig gefunden und deshalb nicht wirklich lieben können. Aber das macht alles nur schlimmer, denn insgeheim ist sie überzeugt: "Es hat etwas mit mir zu tun. Alles um mich herum stirbt." Am Tiefpunkt ihres Lebens fühlt sie sich für alles verantwortlich, selbst für die Resignation und Verzweiflung ihrer Eltern.
Glaubwürdig wird die Figur gerade durch ihre radikale Widersprüchlichkeit, durch ihre Sehnsucht nach Nähe, ihren Trotz, ihre Klugheit und Verletzlichkeit, die besonders im zweiten, in Israel spielenden Teil des Romans aufbrechen. Mascha, unzufrieden mit der selbstgerechten humanitären Organisation, bei der sie arbeitet, provoziert, halb traurig, halb empört, die Israelis um sie herum mit ihrem Arabisch, will sich in diesem zerrissenen Land "häppchenweise verlieren und nie wieder aufsammeln" und ist besonders sympathisch, wenn sie mit allen streitet, die etwas so Bescheidenes wie "politische Normalität" verachten - auch wenn es die scheinbar sanften Frauen einer arabischen Großfamilie sind. In einem Interview erklärte Olga Grjasnowa, dass sie hier, wo sie auch eine Zeitlang gelebt hat, viele Besonderheiten des armenisch-aserbeidschanischen Konflikts besser verstehen lernte.
Eine verdrehte Heimkehr, die als Flucht begann. So kunstvoll wie in Filmen von David Lynch flackern Hoffnung und Verderben ineinander, denn Mascha verliebt sich ständig falsch: zuerst in einen sanftmütigen, Elias ähnelnden israelischen Soldaten, dessen Einberufung sie hysterisch werden lässt, dann in eine traumatisierte Pazifistin, die, wie sie, den Krieg in der Seele trägt und sie politisch missbraucht. Bei ihrer verzweifelten Suche nach dem toten Geliebten reagiert sie auf jede Geste und jedes Körperdetail, überall scheinen die Bilder und Geräusche ihres Kinder-Albtraums auf, und sie durchlebt Brutalität und Ausweglosigkeit wieder so ungeschützt wie damals. Das ist klug und spannend erzählt, mit einem beunruhigend offenen Ende. Von Panikattacken geschüttelt steht Mascha auf dem Feld neben einem palästinensischen Flüchtlingslager im Kriegszustand, hinter dem Hügelkamm leuchten drohend - oder hoffnungsvoll? - die adretten, roten Ziegeldächer einer israelischen Siedlung. Kein glücklicher, aber auch kein hoffnungsloser Schluss.
NICOLE HENNEBERG
Olga Grjasnowa: "Der Russe ist einer, der Birken liebt". Roman.
Hanser Verlag, München 2012. 288 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Dass Olga Grjasnowa ... sich erzählerisch unerschrocken, ja leichtfüssig zwischen Kulturen und Religionen bewegt, beschert dem Roman eine faszinierende, zeitgemässe Exotik." Sibylle Birrer, Neue Züricher Zeitung, 31.01.2015
"Hier kommt die Welt zu Ihnen, wie sie noch nie zu Ihnen gekommen ist in einem Roman. Mit Macht, mit Witz, mit Weisheit, mit Scharfsicht und Scharfsinn, mit Tempo und Trauer." Elmar Krekeler, Die Welt
"Olga Grjasnowa trifft aus dem Stand den Nerv ihrer Generation. Zeitgeschichtlich wacher und eigensinniger als dieser Roman war lange kein deutsches Debüt." Ursula März, Die Zeit, 15.03.12
"Ein faszinierender Roman, ein sprunghaftes Stationendrama rund um die Heldin mit dem Tschechow-Namen (...) kraftvoll, dialogstark, anmutig." Meike Fessmann, Süddeutsche Zeitung, 24.03.12
"Grjasnowa besitzt den Mut, eine Heldin vor uns hinzustellen, die in einer Gesellschaft, die inzwischen vor allem Gefügigkeit und Stromlinienförmigkeit prämiert, mit einer geradezu herausfordernden Eigensinnigkeit daherkommt. (...) Trotz, Durchsetzungsvermögen und permanente Lernbereitschaft bilden ihre Waffen. Als rote Zora (...) stürmt sie durch die globalisierte Welt. Ein so ungeschminktes Bild derselben hat man selten so temperamentvoll hingepfeffert bekommen wie in diesem Buch. (...) Mit diesem Buch gibt eine Erzählerin ihr Entréebillet für die deutsche Literatur ab, von der man sich noch viel erhoffen kann." Tilman Krause, Die Welt, 31.03.2012
"Er (der Roman) passt in keine Schublade. Es ist einfach ein starkes Erzähldebüt einer vielversprechenden Autorin." Hajo Steinert, Tages-Anzeiger, 06.06.12
"Hier schreibt eine Frau, von der man mehr lesen möchte." Cornelia Geissler, Berliner Zeitung, 14.06.12
"Der Roman liest sich flott weg, der raschen Mascha will man unbedingt folgen, denn Humor hat sie auch. Was für eine Bereicherung." Barbara Schäfer, Stuttgarter Zeitung, 15.06.12
"Szenisch stark, wort- bildmächtig, entwickelt Olga Grjasnowa einen Sog, der mitreisst in eine globalisierte Welt, die immer wieder explosiv auf eine von Kleingeistigkeit und Misstrauen beherrschte Enge prallt." Sandra Leis, NZZ am Sonntag, 24.06.12
"Hier kommt die Welt zu Ihnen, wie sie noch nie zu Ihnen gekommen ist in einem Roman. Mit Macht, mit Witz, mit Weisheit, mit Scharfsicht und Scharfsinn, mit Tempo und Trauer." Elmar Krekeler, Die Welt
"Olga Grjasnowa trifft aus dem Stand den Nerv ihrer Generation. Zeitgeschichtlich wacher und eigensinniger als dieser Roman war lange kein deutsches Debüt." Ursula März, Die Zeit, 15.03.12
"Ein faszinierender Roman, ein sprunghaftes Stationendrama rund um die Heldin mit dem Tschechow-Namen (...) kraftvoll, dialogstark, anmutig." Meike Fessmann, Süddeutsche Zeitung, 24.03.12
"Grjasnowa besitzt den Mut, eine Heldin vor uns hinzustellen, die in einer Gesellschaft, die inzwischen vor allem Gefügigkeit und Stromlinienförmigkeit prämiert, mit einer geradezu herausfordernden Eigensinnigkeit daherkommt. (...) Trotz, Durchsetzungsvermögen und permanente Lernbereitschaft bilden ihre Waffen. Als rote Zora (...) stürmt sie durch die globalisierte Welt. Ein so ungeschminktes Bild derselben hat man selten so temperamentvoll hingepfeffert bekommen wie in diesem Buch. (...) Mit diesem Buch gibt eine Erzählerin ihr Entréebillet für die deutsche Literatur ab, von der man sich noch viel erhoffen kann." Tilman Krause, Die Welt, 31.03.2012
"Er (der Roman) passt in keine Schublade. Es ist einfach ein starkes Erzähldebüt einer vielversprechenden Autorin." Hajo Steinert, Tages-Anzeiger, 06.06.12
"Hier schreibt eine Frau, von der man mehr lesen möchte." Cornelia Geissler, Berliner Zeitung, 14.06.12
"Der Roman liest sich flott weg, der raschen Mascha will man unbedingt folgen, denn Humor hat sie auch. Was für eine Bereicherung." Barbara Schäfer, Stuttgarter Zeitung, 15.06.12
"Szenisch stark, wort- bildmächtig, entwickelt Olga Grjasnowa einen Sog, der mitreisst in eine globalisierte Welt, die immer wieder explosiv auf eine von Kleingeistigkeit und Misstrauen beherrschte Enge prallt." Sandra Leis, NZZ am Sonntag, 24.06.12