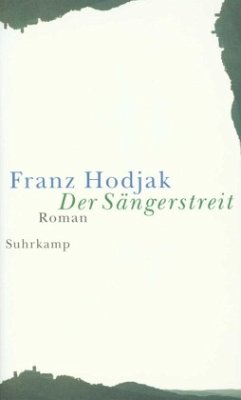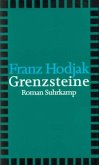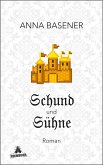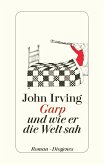Klingsor, Pferdedieb oder besser: Pferdehändler aus Siebenbürgen, begibt sich auf die Wartburg, um an einem Sängerstreit teilzunehmen. Er gerät in eine ganz fremde Welt: Der Sängerstreit hat längst stattgefunden, vor einem Jahr oder vor langer Zeit oder niemals. Wachen, Ritter, Artisten, ein Tanzbär, Zöllner, Gefangene bevölkern die Burg, auf der eigenartige Gesetze herrschen. Am merkwürdigsten freilich ist der Burgherr selbst, ein Tyrann mit musischen Neigungen und philosophischen Ambitionen. Alles scheint verkehrt hier: Unrecht, Verrat und Feigheit werden mit klugen Gründen gepriesen. Hodjak erzählt immer neue schillernde Geschichten, in denen die Figuren ihre Rollen tauschen, Sinn Unsinn wird, Grausamkeit komisch. Und umgekehrt. In einer skurrilen Parabel scheint eine gar nicht so ferne Welt auf, der man nur listenreich entkommen kann, wenn sie sich denn nicht ändern läßt.

Franz Hodjak entführt Klingsor auf die Wartburg
Es ist etwas hochgradig Hybrides und Anachronistisches an Franz Hodjaks Geschichte von Klingsor, dem siebenbürgischen Pferdedieb, und seinen Abenteuern auf einer außerhalb von Zeit und Raum schwebenden Wartburg. Nichts ist der Überlieferung geschuldet: Der Burgherr der Wartburg treibt sein komisches Unwesen allein im Auftrag einer resoluten Einbildungskraft. Franz Hodjak kommt aus Siebenbürgen - muss aber da nicht der Burgherr auch ein Diktator aus Rumänien sein? Und so wie Landgraf Hermann auf seiner Burg regiert, so selbstherrlich und wahnwitzig, möchte man an allegorische Winke fast glauben.
Hodjak, 1944 in Klausenburg geboren, lebt seit 1992 in Deutschland, hat Lyrik und Prosa veröffentlicht und ist, wie es aussieht, mit seinen Gedanken und Geschichten im Bundesgebiet nie angekommen. Der Roman lebt von starken Bildern, die nicht von dieser Welt stammen. Etwa, wenn sich Klingsor an seine Heimat mit den Worten erinnert: "Es war eine laute Gegend. Sogar der Schnee fiel polternd vom Himmel." Man fühlt sich in eine Welt versetzt, in der Werner Herzog den Brüdern Grimm gute Nacht sagt. Es gibt mächtige Einfälle in diesem Buch, aber die Romanhandlung lahmt ein wenig. Liest man das Buch gern, liest man es gern von vorne nach hinten durch, gerät man gar in einen "Sog"? Nicht wirklich. Aber man ist streckenweise beeindruckt.
Wenn man wunde Füße hat, muss man auf sie pissen, das verhindert Eiterbildung. Dies ist eine Art "running gag" des Romans. Also wird in ihm nach Herzenslust gepisst. Und geschnarcht, gerülpst, gekotzt. Und was passiert sonst? Klingsor ist zum Sängerstreit auf die Wartburg geeilt und muss erfahren, dass dieser schon vor einem Jahr stattgefunden hat. Der diese Auskunft erteilt, ist der Burgherr, ein Mann mit grausamen und musischen Zügen. "Glücksgefühle", so teilt er Klingsor mit, seien "Schwächeanfälle der Bewusstseins", und nach diesem finsteren Motto befördert der Burgherr sein Gesinde vom Leben zum Tode oder seine Gefangenen von jetzt auf gleich zu "Ehrenrittern". Klingsor solle ihm sein Leben erzählen, aber die Geschichte werde ohnehin so langweilig sein, dass er nach dem dreiundzwanzigsten Satz einschlafen werde.
Also erzählt Klingsor, von seiner Laufbahn als Totenwäscher, Glöckner und Pferdehändler im fernen Siebenbürgen, von einem Kräuterweiblein, das den Knaben aus dem betrunkenen Leib seiner Mutter herausgezogen und ihn vor dem brandschatzenden und mordenden Osmanenheer errettet hat, und davon, wie er über mancherlei Stationen von Preßburg bis Lüneburg am Ende die Wartburg erreicht hat. Kein uninteressanter Stoff, doch den Burgherren hat trotzdem der Schlaf übermannt. "Inzwischen", heißt es an einer charakteristischen Stelle des Romans, "wurden drei Burgwächter erhängt, zwei erschossen, sieben ertränkt, achtzehn zu Tode gepeitscht, vier vom Felsen heruntergestoßen, einundsiebzig verbrannt" und "zwei sollten gekreuzigt werden". In Hodjaks Roman wird viel gezählt, und seine Übertreibungen rücken die geschilderten Untaten in die Nähe einer anderen Art Ordnungsliebe. Der Burgherr will Ordnung machen mit seinem Regime, oder nein, er will Platz schaffen für eine "neue Unordnung, immer mit der gleichen Unordnung zu leben stumpft den Geist ab".
In dieser verkehrten Wartburgwelt, wo Tanzbären als oberste Ritter fungieren, scheint allein des Burgherren misstrauische Zuneigung zu dem siebenbürgischen Pferdedieb eine verlässliche Größe. Vor ihm und nur vor ihm möchte der Herr aller Grausamkeiten seine zarte Seele aussprechen. Und Klingsor darf seinerseits dem Burgherren von Siebenbürgen, der metaphysischsten Landschaft unter der Sonne, erzählen. "Es war eine kosmische Melodie", sagt Klingsor, die dort "die ganze Gegend erfüllte". Klingsors Siebenbürgen ist das verlorene Reich einer poetischen Inspiration, ein Reich, in dem selbst eine Entjungferung ein poetischer Akt war, denn "sie hatte den Hauch von etwas, das sich gegen die Ewigkeit stemmt, die auf diesem Landstrich lastete".
Während Klingsor sein großes Verklärungswerk an der siebenbürgischen Landschaft vollbringt, reden die Gefangenen auf der Wartburg allerlei blühenden Unsinn, um sich die Zeit bis zur Hinrichtung oder Beförderung zu vertreiben. Ja, der Unsinn in Hodjaks Roman blüht wirklich aus allen Ritzen, und es wird ihm eine beinahe theoretische Behandlung zuteil, wenn der Burgherr Klingsor erklärt, er müsse seinen Untergebenen Unsinniges abverlangen, denn "die absolute Treue kann nur daran gemessen werden, inwieweit die Gefolgschaft den Unsinn akzeptiert . . . Wenn es eine echte Treue gibt, dann muss sie bereit sein, dem Unsinn bis zum Ende zu folgen." Und wie der Unsinn ein Test auf die Treue, so sei die Intrige ein Test auf die Freiheit. So redet sich der Burgherr in Trance, zwischendurch straft er ein wenig, und am Ende kommt es dann auch noch zu einem Sängerstreit, aus dem Klingsor als ehrenvoller Verlierer hervorgeht, woraufhin sich der Burgherr von Klingsor mit den Worten verabschiedet, er werde ihm fehlen und es werde "wieder eine schreckliche Einsamkeit in mein Hirn einkehren". Was war nun der Sinn und was der Unsinn hinter all dem Mummenschanz? Die Welt ist furchtbar und lustig und aus dem Lot, und keine Heimat macht sie wieder heil, denn, so sagt Klingsor zum Abschied, "der Ekel ist die einzige Heimat, die ich kenne".
CHRISTOPH BARTMANN
Franz Hodjak: "Der Sängerstreit". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 192 S., geb., 36,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Samuel Moser preist das Abgründige in Hodjaks Roman, die Figurenkonstellation findet er schlechterdings genial. Das groteske Geschehen voll "zynischen Humors" löse sich nicht in Heiterkeit auf, sondern bewahre seine finstere Seite. Hervorhebenswert ist Moser die politische Dimension des Romans. Er nimmt an, dass Hodjak als deutschstämmiger Rumäne tiefere Einsichten in die Funktionsweise diktatorischer Befehlshaber "von Nero bis Ceausescu" habe als manch anderer und diese in seinem Text fruchtbar verwertet hat. Eine "verstörende Erfahrung" war die Lektüre dieses Romans für den Rezensenten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH