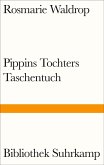»Ein paar Geliebte hatte ich, die wie Teeschalen waren, in die ich mich jeden Abend vertiefen wollte.« Die das sagt, ist nicht die Sorte Mensch, sich von Rührung beeindrucken zu lassen. Aber der traurige Student im Pierrotkostüm fällt ihr auf. Und als er eines Abends auf der Treppe vor ihr sitzt, nimmt sie ihn mit.Der Hof einer japanischen Universität, ein abgelegenes Dorf in der Ukraine, Berliner Clubs, ein Bus, der sich seinen Weg durch die nächtliche algerische Wüste sucht - das sind nur ein paar der Orte, an denen die Helden dieser Erzählungen unterwegs sind, immer in den einen oder anderen Anblick versunken, immer bereit, vor der Liebe die Flucht zu ergreifen, um der Schönheit selbst ins Gesicht zu sehen.Schwungvoll spannt Ann Cotten einen schillernden Fächer auf - aquarellierte Seegurken auf der einen Seite, auf der anderen Menschen in Liebeswirren. Die Wendigkeit ihrer Lyrik findet sich auch in diesen Erzählungen: Sie sind verspielt und zynisch, offenherzig und doch unwiderstehlich.
»… denn genau darum geht's: dass Denken Zärtlichkeit ist.«
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Lothar Müller freut sich, dass mit "Der schaudernde Fächer" nun ein neuer Erzählband der in Iowa geborenen und auf Deutsch publizierenden Schriftstellerin Ann Cotten erschienen ist. Schon seit ihrem Debütwerk schätzt der Kritiker die Autorin für ihr kunstvolles Spiel mit der Sprache, deren Sinnlichkeit sich ganz auf ihn überträgt. Und so taumelt Müller fasziniert durch die "galoppierende Metaphernflucht", durch Berlin und Japan und liest in dem lebhaften Dreieck aus Lyrik, Essay und Prosa von Reiseerfahrungen, Geschlechtsumwandlungen und der oft "komisch-ernsten" Sexualität junger Männer und Frauen. Cotten gelinge es eine Form des Erzählens zu finden, die sich dem Unvorhersehbaren des Lebens auf wunderbare Weise anpasse, lobt der eingenommene Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Expressionistische Reflexionsprosa für die digitale Bohcme: Ann Cotten geht in ihrem Buch "Der schaudernde Fächer" neue Wege des Erzählens.
Von Jan Wiele
Wie geht man mit jemandem um, den man als Badewanne benutzt? Was unterscheidet eigentlich Lyrik von Prosa? Und was macht man mit einem Buch, bei dem man mit jeder bewältigten Seite kaum noch Erinnerung daran hat, was auf der vorherigen stand? Das sind so Fragen, die sich beim Lesen von Ann Cottens Band "Der schaudernde Fächer" stellen. "Erzählungen" sollen das sein, aber was eine Erzählung ist, das scheint nach dieser Lektüre so unklar wie kaum je zuvor.
Fast genau hundert Jahre ist es jetzt her, dass Carl Einstein in seinem Text "Bebuquin" mit Sinngebung, Form und vor allem Perspektive bisherigen Erzählens radikal gebrochen hat. Fast hundert Jahre ist es auch her, dass der Sprachavantgardist Walter Serner in seiner "Letzten Lockerung" hart mit allen ins Gericht ging, die "aus dem Leben, das unwahrscheinlich ist bis in die Fingerspitze", erzählend etwas Wahrscheinliches machen wollten und gar "über dieses Chaos von Dreck und Rätsel einen erlösenden Himmel stülpen" und "den Menschenmist ordnend durchduften".
Von solchen allzu rigiden Ordnungsversuchen scheint auch Ann Cotten weit entfernt, die 2007 mit ihrem Debüt "Fremdwörterbuchsonette" zwar, wie einige meinten, eine ganz neue Gattung der Lyrik begründet hat, sich in ihrem letzten Buch "Floridaräume" (2011) allerdings über alle Grenzen hinweggesetzt hat - neben Gedichten finden sich darin auch Texte, die als "Ausschüttung" oder "Bericht eines Datenträgers" klassifiziert sind. In diesem Buch ist einmal die Rede von einer "Halbschläferin", deren literarisches Wirken überall da beginnt, "wo ihr der Schreibtisch gewachsen ist" - und es liegt nahe, darin die Autorin zu sehen. Cottens sprachliche Kunstwerke haben oft die dichterische Produktion zum Thema: Ihre Lyrik ist poetologische Lyrik, ihre Prosa könnte man mit einem etwas in Vergessenheit geratenen Begriff als expressionistische Reflexionsprosa bezeichnen. Zweifelsohne teilt sie mit den Avantgardisten der Frühmoderne die grundsätzliche Sprach- und Erzählskepsis.
Damit soll aber nicht gesagt sein, dass Cottens Prosa von gestern ist, sie ankert in vielerlei Hinsicht sogar sehr im Heute: Das Gros der Texte hat seinen Sitz im Berlin des neuen Jahrtausends, wo die 1982 in Iowa Geborene und großteils in Wien Aufgewachsene seit 2006 lebt. In diesen Texten mit Titeln wie "Idyllen. Chillen" mäandert ein weibliches Ich durch Schöneberg und durch Wohngemeinschaften. Man trägt lila Röhrenjeans und sitzt "auf irgendwelchen Stufen mit Bier vom Spätkauf".
Die Erzählerin ist sowohl Teil einer jungen Bohcme als auch kritische Beobachterin: "Da waren Kunstinstallationen zu sehen, pastellene, prämierte Jugendfantasien wie immer in den selbstgemachten Hinterhofgalerien dieser Tage", heißt es einmal. Ästhetische Diskurse fließen in Gespräche ein, manchmal so kryptisch, dass man kaum folgen kann. Ein Text über "Schönheitstheorie" verspricht klarere Gedanken und fragt: "Wie wissen wir, dass es sich um Schönheit handelt? Durch unsere Reaktion. Worin besteht die?" Die Antwort: "Um nicht zu weinen, lieber schreiben. Da kann ich wie in der Musik, während ich den Strahl schwarzen Unmuts, ohnmachtschwelgenden Widerwillens gegen die Einrichtungen absondere, diesen Strahl selbst launisch und anmutig gestalten."
Etwas leichter und Woody-Allen-hafter wirkt ein Intellektuellengespräch zwischen zwei jungen Frauen. Die erörtern anhand eigener Erfahrungen, ob man "deprimierende Liebesaffären durch die Kraft der Kunst in vergnügliche verwandeln" kann, aber: "Natürlich kam das Desaster. Dann flippte er aus und alles war ausgeleiert. Es gab keinen reset button." Andere Prosastücke führen in die Welt hinaus, in die Karpaten und nach Japan - aber auch sie kreisen immer um das schreibende Ich. Aus dem "Nachmittag eines Schriftstellers", wie ihn Fitzgerald und Handke verbrachten, wird bei Ann Cotten allerdings eine Afterhour nach durchtanzter oder auf dem Trip verbrachter Nacht: Mal ist die Rede von LSD, mal nur vom "Weizenbier als Tonikum".
Das alles dient einer gnadenlosen Analyse der Empfindungen, etwa, als die Erzählerin einige Stunden in Erwartung einer Verabredung schildert, genauerhin eines "dubiosen Essens-Dates zum Zweck des Beischlafs". Vor den Gerüchen des Menschenmists hat Ann Cotten keine Angst. Moderne Erscheinungen wie ein Raumparfümierer lösen bei ihrer Erzählerin dagegen den Verdacht aus, "eine unbekannte Instanz sei dabei, mir von oben Knock-Out Drogen zu verpassen". Diese Befürchtung passt zur Erfahrung dieser fordernden wie bereichernden Lektüre.
Ann Cotten: "Der schaudernde Fächer".
Erzählungen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 251 S., geb., 21,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»In ihrer Prosa ... sucht Ann Cotten nach einer Erzählform, die es mit dem Sprunghaften des Lebens aufnehmen kann und eine Sinnlichkeit entfaltet, deren Kern die Sprachlust ist.« Lothar Müller Süddeutsche Zeitung 20131214