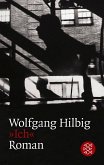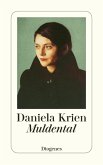Ein Mann geht zum Briefkasten und gerät in seiner Erinnerung auf den täglichen Weg zur Arbeit im unheimlichen Heizkraftwerk einer Fabrik. Ein anderer entdeckt eine abgelegene Insel in einem See, auf der die Natur ein wucherndes, magisches Regiment entfaltet, und betritt noch einmal die Wildnis einer Nachkriegskindheit. Ein dritter kehrt in seine Heimatstadt zurück und fühlt sich verfolgt - nicht nur der Stadt, auch sich selbst entkommt er nicht.
Wolfgang Hilbigs Figuren folgen einer verwischten Spur ins Unbewusste und Vergangene, die sich durch dunkle Erinnerungslandschaften zieht. Den Leser führt diese suggestive und musikalische Prosa in die unausgeloteten Tiefen der fünfziger und sechziger Jahre.
Wolfgang Hilbigs Figuren folgen einer verwischten Spur ins Unbewusste und Vergangene, die sich durch dunkle Erinnerungslandschaften zieht. Den Leser führt diese suggestive und musikalische Prosa in die unausgeloteten Tiefen der fünfziger und sechziger Jahre.

Expeditionen im Kellergewölbe der Geschichte: Wolfgang Hilbigs Erzählband "Der Schlaf der Gerechten"
Wolfgang Hilbig ist der Wahrheit auf der Spur. Hat er sie einmal ausgemacht, fürchtet er sich nicht, ihr frontal ins Gesicht zu schauen. Seine Methode ist jene der Langsamkeit, sein taktischer Vorteil der Hang zu bleischwerer Beharrlichkeit. Zäh und lautlos wie ein Jäger nimmt er die Spur des Wildes auf. Mit einer fast einschläfernden Ruhe entwickelt er seine Geschichte, um dann plötzlich, aus dem Stand heraus, präzis und brutal zuzuschlagen. Nur: Wer ist das Wild, wer das bevorzugte Objekt seiner Beobachtung? Umzingelt er in seinen neuen Erzählungen "Der Schlaf der Gerechten" die private Beziehungsgeschichte? Beobachtet er das beklemmende Eingeschnürtsein seines Ich-Erzählers zwischen Mutter und Gattin, zwischen Gattin und Geliebten? Oder umkreist er - auch wenn es im ersten Moment gar nicht so scheinen mag - wieder die BRD und die DDR, die alte Heimat, die anziehend-abstoßende Geliebte?
Wolfgang Hilbig arbeitet wie schon in seinem dämonischen Roman "Das Provisorium" (2000) mit der gezielten Überblendung mehrerer Erzählebenen; eine Strategie, die seine Texte auf eine verstörende Weise verdichtet, wobei dem Leser die letzten Fragen zwar gestellt, aber nie beantwortet werden. Sieben Erzählungen versammelt Hilbig in dem Band "Der Schlaf der Gerechten". Die meisten sind bereits in Literaturzeitschriften und Anthologien erschienen. Flankiert werden sie von zwei Erstveröffentlichungen - "Ort der Gewitter" und "Der dunkle Mann". Es sind die stärksten Texte des Buches. Kein Wunder, daß genau sie vom autobiographischen Substrat leben. Der 1941 geborene Autor hat, wir wissen es, eine beinahe "exemplarische" deutsche Autoren-Vergangenheit: Geboren wurde er in Meuselwitz bei Leipzig, 1985 übersiedelte er in die BRD, heute lebt er in Berlin, und losgekommen ist er vom traumatisierenden Kontinent der Kindheit nie. Also ist es wieder das Vater- und Mutterland, das er erzählerisch umstellt. Also sehen wird wieder die DDR mit ihren Fallstricken aus Lügen, Verdächtigungen und Heucheleien, an denen die Bürger baumeln. Also werden wir wieder konfrontiert mit dem Säurebad der Überwachungskultur, welche das Zusammenleben der Bürger zersetzt. Aber wir tauchen auch in die Nachtseiten des Ich-Erzählers ein, beobachten seine schwerblütigen Beziehungen, seine kühne Einsamkeit, seine neurotischen Verstrickungen, studieren die fatalen Abhängigkeiten und lähmenden Zwänge, an denen er klebt. Und wir kehren mit ihm zurück auf das Territorium der Kindheit, dorthin, wo alles seinen Anfang genommen hat.
"Ort der Gewitter", die Eingangserzählung, ist eine solche Kindheits-Etüde. Auffällig an diesem Text ist, daß er um eine klaffende Dauerlücke angeordnet ist: Die Position des Familienvorstandes ist unbesetzt. Es ist Nachkriegszeit, Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre in diesem DDR-Dorf mit seinen Trümmerfeldern, aus denen schwarzes Gebälk und Ruinenwände ragen: Reste ehemaliger Munitionsfabriken, in denen während des Kriegs die Gefangenen der Konzentrationslager gearbeitet haben. Wahrheit, auf die Wolfgang Hilbig aus ist, heißt hier: die Fratze des Krieges erkennen und die Spuren der Verwüstung benennen, die sie in den Menschen zurückgelassen hat. Viele der Kinder, die verwahrlost auf den Bürgersteigen herumlungern, sind vaterlos. Ihre Tage verbringen sie herumstreunend, auf den Eingangsstufen vor den Haustüren sitzend, die wegen des Kohlestaubes immer geschlossen sind, sich zu Banden zusammenrottend, die in fremden Kellern nach vergessener Munition wühlen. Wie schon in früheren Büchern evoziert Wolfgang Hilbig das Drama des vaterlosen Kindes, das in einem Vakuum erwachsen werden soll, mit einem einzigen, grandios schlichten Bild: Der Knabe liegt im Doppelbett neben der Mutter. Der Vater, so erfährt man, ist in den Eisfeldern von Stalingrad verschollen. Es sind diese blitzschnell eingeblendeten Imaginationen, mit denen die ungeheuerliche, zu Tode geschwiegene Not einer ganzen Generation eingefangen wird. Das Kind nämlich erwacht im Vaterbett und erkennt sich auf einmal im Spiegel auf der anderen Zimmerseite wieder; wie es jetzt von einem Gefühl der Fremdheit überfallen wird, von diesem Eindruck wankender Bodenlosigkeit, da es im eigenen Spiegelbild keine Spur von Ähnlichkeit mit dem bräunlichen Porträtbild des Vaters mit dem Stahlhelm entdeckt, und wie es sich selbst in der eigenen Verspiegelung immer verlorener vorkommt, das sagt auf knappstem Raum mehr über den Selbst- und Identitätsverlust und über das ambivalente Verhältnis einer Generation zu ihren Kriegervätern, als dies ganze Untersuchungen zu leisten vermöchten.
Gegenstück dazu ist die Erzählung "Der dunkle Mann". Virtuos führt Hilbig die Brechung der eigenen Geschichte im historischen Drama vor. Er deckt die Wahrheiten im Faltenwurf der Geschichte auf und führt literarisch die Relativität jedes definitiven Urteils vor. Denn obwohl der Schriftsteller mit der Figur des Stasi-Spitzels, der das Privatleben seines Ich-Erzählers schamlos ausspioniert, die Würdelosigkeit dieses Staates und seine höhnische Respektlosigkeit vor der Privatsphäre des einzelnen kraß vor Augen führt, gibt er uns am Ende doch keine Gewißheiten und schon gar keinen Schiedsspruch in die Hand.
Es gibt in diesem Text kaum feste Standorte - nur schwimmende Flöße, von denen aus die Landschaft überblickt werden kann. Ein Schriftsteller, der mit seiner Frau seit längerem im Streit lebt, erhält eines Abends einen dubiosen Anruf. Was sich ihm vorerst verhüllt, wird ihr sofort klar: Es gibt eine geheime Verbindung zwischen dem Mann im Dunkeln und den wild entbrannten Diskussionen über die Archive der Staatssicherheit, die eben geöffnet wurden. Hilbig läßt an dieser Stelle auch die emsigen deutschen Schriftstellerkollegen nicht ungeschoren, die, wie es heißt, "auf dem Bildschirm vorwärts und rückwärts über die Öffnung einiger Tonnen von Stasi-Akten redeten" und sie, so schien es ihm, "zum Hauptthema ihres literarischen Lebens machen wollen, wohl in Ermangelung eines anderen, eigenen Themas". Er könne, meint der Ich-Erzähler spottend, den Verdacht nicht unterdrücken, "die auf einmal öffentlich zugänglichen Akten hätten ihnen ihr literarisches Leben gerettet". Der mysteriöse Anrufer entpuppt sich als feiger Überwacher, der sich jetzt, da die Verhältnisse gekippt sind, rechtzeitig mit seinem Opfer arrangieren möchte - bevor ihn die Rache des Verfolgten treffen würde.
Was Wolfgang Hilbig erzählstrategisch unternimmt, verdient Beachtung: Er zeigt Opfer und Täter in einem grotesken Totentanz, der alle Qualitäten einer Umarmung verkörpert: Das Spiel entwickelt sich nach den Regeln der Erotik. Es geht von der Annäherung durch das Locken des Täters über die Berührung durch seine niederträchtigen Konfessionen bis hin zur Verschmelzung der Gegner, der Tötung des Spitzels und der kaltblütigen Entsorgung des Leichnams durch das Opfer - wobei sich Opfer und Täter in der verbissenen Todes-Umklammerung immer ähnlicher werden. Ganz abgesehen davon, daß Wolfgang Hilbig erneut seine ebenso bildstarke wie dramaturgische Gestaltungskraft unter Beweis stellt: Die Geschichte hat ihre großen literarischen Qualitäten, weil es dabei keineswegs bleibt. Im Gegenteil, die politische Sequenz ist auf feinste Weise verschränkt mit der Ehegeschichte zwischen dem schwerenöterischen Schriftsteller und seiner coolen Frau aus dem Westen. Und die Karikatur des turbulenten Ehelebens im West-Häuschen, in dem einfach kein Frieden sein kann, ist wiederum eng verwoben mit der Mutter-Sohn-Geschichte, die einen Sohn zeigt, der nur am Rockzipfel der Mutter überleben und nur im Lichtschein ihrer Stubenlampe schreiben kann.
Natürlich wird damit "Der dunkle Mann" zum Gleichnis des krisenhaften Annäherungsprozesses der beiden Deutschland. Nur: Wolfgang Hilbigs Sätze führen auf ihrer Oberfläche keine Thesen mit sich, seine Helden verkündigen keine Botschaften, und der Autor läßt sich von keiner Seite vereinnahmen. Beeindruckend wird der Text gerade durch seine feine, hochdifferenzierte Textur. Es sind Recherchen im verschütteten Gelände, Expeditionen im angsterregenden Kellergewölbe der Geschichte.
Wolfgang Hilbig: "Der Schlaf der Gerechten". Erzählungen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 192 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Wolfgang Hilbig beschreibt Gerüche, Staub und Hitze so, dass der Leser riecht, schnieft, schwitzt und die letzten Seiten mit rußgeschwärzten Fingern umblättert. Berliner Zeitung