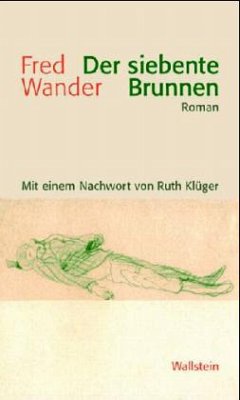"Der Schlüssel zu diesem Werk ist ein Erzähler, der nie den staunenden Blick, mit dem jeder das Leben anfängt, verloren hat. Das Böse, so oft er sich damit konfrontiert sah, verursachte mehr Kopfschütteln als Haß. Freilich kommt die Auseinandersetzungmit dem Bösen seiner Menschenliebe in die Quere, aber jenes kann diese in ihren Grundfesten nicht erschüttern. Wie er an dieser Menschenliebe festhält - nämlich nicht mit Grundsätzen, ob philosophischer oder theologischer Provenienz, sondern mit der Neugier des Beobachters verschiedener Leute - das macht den eigentümlichen Reiz dieses Buches aus, seine Originalität, den Unterschied zu anderen Büchern über die Lager." (Ruth Klüger, aus dem Nachwort)
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Erika Deiss jubelt über die Neuauflage von Fred Wanders Roman. 1971 erstmals erschienen (und leider seitdem in Vergessenheit geraten), sei "Der siebente Brunnen" eines der ersten Werke, in denen neue literarische Möglichkeiten des Sprechens "über das Unkommunizierbare, die unbeschreiblichen Verbrechen der Vernichtungslager" eröffnet wurden. Die Sprache Wanders, schreibt Deiss, ist "so luzid wie lapidar", und erzeugt mit ihrer stilistischen Wendigkeit, ihrer "fulminanten Musikalität" und einer "überwältigenden Pracht der Bilder" eine Unmittelbarkeit der Erfahrung, die mehr als nur eine Leseerfahrung ist. Wander setzt sie ein, um Hoffnung zu vermitteln: Glauben an die menschliche Stärke und an das Glück des Lebens im Angesicht des Grauens. "Beschaulichkeit mit Widerhaken", nennt das die Rezensentin und sagt voraus, dass niemand, der das liest, "ohne ein Würgen in der Kehle" davonkommen wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Fred Wanders "Der siebente Brunnen" in einer Neuausgabe
Sechzig Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes liegt eine große Zahl von dokumentarischen und fiktionalen Texten vor, die sich den Mord an den Juden und das Leben und Sterben in den Konzentrationslagern zum Gegenstand gemacht haben. Dieses Datum mag Anlaß für den Wallstein Verlag gewesen sein, ein frühes Zeugnis einer solchen literarischen Auseinandersetzung erneut zugänglich zu machen und Fred Wanders zuerst 1971 im Aufbau Verlag erschienenen Roman "Der siebente Brunnen" wiederaufzulegen.
Sein Autor, 1917 als Fritz Rosenblatt in Wien in eine verarmte jüdische Kleinbürgerfamilie hineingeboren, verließ als Vierzehnjähriger die Schule, schlug sich als Gelegenheitsarbeiter durch, floh 1938 vor den Nationalsozialisten über Paris in die Schweiz, wo er, erneut ausgewiesen, 1942 als "feindlicher Ausländer" interniert und vom Lager in Perpignan über Drancy nach Auschwitz, Groß-Rosen und nach Buchenwald deportiert wurde. Rosenblatt überlebte, kehrte nach Wien zurück, wählte 1950 den Namen Wander, mit dem er das Ahasverische, Weltwandernde seiner Existenz zu betonen suchte, und arbeitete als Reporter, Fotograf und Zeichner. Mit seiner Frau Maxie, die später durch ihr Buch "Guten Morgen, du Schöne" bekannt wurde, ging er 1958 in die DDR, wo er nach ihrem Krebstod lebte, um 1983 erneut nach Wien zurückzukehren.
Auslöser für "Der siebente Brunnen" war laut Wander der Unfalltod seiner Tochter Kitty im Jahr 1968, ein Anlaß, über die Männer zu schreiben, die in den Lagern geblieben und dort umgebracht worden waren, und so "die anonymen Toten wieder lebendig werden zu lassen". So entstand der trotz geteilter Reaktionen in der DDR 1972 mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnete Roman, der Form nach eher eine Aneinanderreihung von zwölf Erzählungen.
Sie stellen Figuren vor, die in wechselnden Konstellationen im Mittelpunkt stehen oder als Nebenfiguren eine Rolle spielen. Der Erzähler selbst bleibt weitgehend Beobachter eines "Totentanzes erinnerter Männer und eines Querschnitts durch das europäische Judentum, das es einmal gab und nie mehr geben wird", wie Ruth Klüger in ihrem Nachwort zur Neuausgabe schreibt.
Zu den Figuren gehören Mendel Teichmann, ein Geschichtenerzähler chassidischer Tradition, dessen Wort magische Kraft hat, ein Zaddik, ein stiller Gerechter, der die Grauen des Lagers und die Untaten der "Gestiefelten", der Lageraufseher, mit "traurigen, forschenden Augen" betrachtet und "eine Formel zu finden versucht" für deren Brutalität. Oder Karel, ein Medizinstudent, der in der alten Welt sein Studium der Frauen wegen hintanstellte und sich nun im Lager über fehlende Fertigkeiten grämt, weil er den kranken Häftlingen seine medizinischen Fähigkeiten zur Verfügung stellen will. De Groot gehört zu ihnen, ein Schneider, der vor der Deportation ein hedonistisches und lustvolles Leben geführt hat, Erich Pechmann, der mit fünf Fingern auf einem Holzbrett Blues spielen kann, einer, bei dem "Gott versucht hat, den guten Menschen zu backen". Oder Jacques, der Résistancekämpfer, der den Aufsehern Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg ins Gesicht brüllt. Tadeusz Moll, ein schöner junger Mann aus gutem Hause, der an den Gasöfen von Auschwitz gearbeitet hat, den ein Schutzengel davor bewahrt, dort zu sterben, und den in Buchenwald doch der Tod ereilt. So entsteht unter den durch die Inhaftierung Gleichgemachten eine Typologie von Charakteren, die bis in die einzelnen Idiome hinein ausdifferenziert ist.
Sie erinnern sich, um den unerträglichen Zuständen im Lager zu entkommen, der Zeit vor dem Lager, der Freuden des Alltags, der Poesie und Musik, der Zeit im Widerstand, der religiösen Rituale, Sabbatfeiern und Gebete in einer jüdisch-orthodoxen Welt, die an die Romane Isaac B. Singers oder Manès Sperbers denken läßt, ohne jedoch deren Dichte zu erreichen.
Gegen diese Charakterbilder und atmosphärischen Beschreibungen setzt "Der siebente Brunnen" Schilderungen des Lagerlebens, der Grausamkeiten, von Folter und Krankheit, des allgegenwärtigen Todes, der nationalsozialistischen Willkür, die um so drastischer auf den Leser wirken müssen, je deutlicher alldem das Humane der Inhaftierten, deren Leiden, ihr Ringen um ein Stückchen hartes Brot gegenübersteht, je deutlicher andererseits ein Kontrast durch wiederkehrende naturmagische Schilderungen entsteht. Schöpfung und Vernichtung prallen aufeinander.
"Der siebente Brunnen" beschwört die Utopie eines "schönen Lebens in Freiheit", die "Reinheit der Herzen". Nicht jeder wird diese emphatische Berufung auf eine Humanität teilen können, die noch die Gesichter der sterbenden Häftlinge als "erhaben" und "von einem seltsamen Leuchten überstrahlt" schildert und das Buch mit dem Satz "So siegt das Leben" enden läßt. Der Erzähler, der die Befreiung in der Kinderbaracke in Buchenwald erlebt, formuliert ihn beim Anblick eines kleinen Jungen, der seinem geschwächten kleineren Bruder mit einem Löffel, den er dem Erzähler gestohlen hat, Wasser auf die Lippen träufelt.
Das Buch steht in scharfem Gegensatz zu anderen fiktionalen und dokumentarischen Texten der inhaftierten Überlebenden. In dem dokumentarischen Essay "Jenseits von Schuld und Sühne" etwa beschreibt Jean Améry seine Existenz im Lager als die einer "fensterlosen Monade, entgeistigt und entmenscht". Glaubens- und Hoffnungslosigkeit haben die Oberhand gewonnen. Bei Wander wird dagegen der Glaube an moralisch-ethische und mystisch-theologische Werte behauptet. Wo die Romane von Jorge Semprún, Imre Kertész oder Primo Levi gerade durch die Distanziertheit des Erzählers gegenüber dem Erzählten erschüttern, irritiert Wanders emotionales Buch nicht in erster Linie durch seine Unmittelbarkeit, sondern durch den ungebrochenen Rückgriff auf traditionelle Schreibweisen.
So erscheint "Der siebente Brunnen" in seiner mangelnden Scheu vor dem Pathos und in seinem beinahe märchenhaften Ton vor dem Hintergrund der philosophischen und ästhetischen Reflexionen auf die Kunst "nach Auschwitz" und der Aktualität seines Gegenstandes zum Trotz seltsam antiquiert. Als Zeit- und Leidensdokument mag das in der DDR vor dem Hintergrund eines staatlich vorgezeichneten Antifaschismus entstandene Buch seine Utopie gegen weniger hoffnungsvolle Perspektiven behaupten. Die "leise literarische Sensation", als die der Roman schon bezeichnet wurde, hätte heute, mehr als dreißig Jahre nach dem ersten Erscheinen und neben der Vielzahl von Romanen gleicher Thematik, die ihre Sprache und die Weisen ihres Erzählens stärker reflektieren, dennoch anders auszusehen.
BEATE TRÖGER
Fred Wander: "Der siebente Brunnen". Roman. Mit einem Nachwort von Ruth Klüger. Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 168 S., geb., 19,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Noch immer sind diese Erinnerungen, die den Toten ihre Würde zurückgeben, ein ganz besonderes literarisches Dokument. Manchmal braucht ein Buch seine Zeit, um die ihm gebührende Anerkennung zu gewinnen. Möge nun endlich Fred Wanders 'Siebenter Brunnen' aufgeschlossene und empfindsame Leser finden." ((Lerke von Saalfeld, SWR 2)
"Der siebte Brunnen meint das 'Wasser der Lauterkeit', aus dem die Menschen gereinigt heraus steigen werden - eine Vision des Rabbi Löw aus Prag. Fred Wander ist mit diesen Brunnen-Wassern gewaschen: Er pflegt keinen bösen Blick; er will nicht punkten, nur einfach aufgehoben wissen. So zeichnete er nach, was ihn erstaunte - die Schönheit jener Menschen, die an seiner Seite gestorben sind." (CEG, Mitteldeutsche Zeitung)
"Dieses Buch darf nicht vergessen werden. Es muss in einem Atemzug mit Primo Levi, Jorge Semprun oder Imre Kertész genannt werden."(Marius Meller, Tagesspiegel)
"Der siebte Brunnen meint das 'Wasser der Lauterkeit', aus dem die Menschen gereinigt heraus steigen werden - eine Vision des Rabbi Löw aus Prag. Fred Wander ist mit diesen Brunnen-Wassern gewaschen: Er pflegt keinen bösen Blick; er will nicht punkten, nur einfach aufgehoben wissen. So zeichnete er nach, was ihn erstaunte - die Schönheit jener Menschen, die an seiner Seite gestorben sind." (CEG, Mitteldeutsche Zeitung)
"Dieses Buch darf nicht vergessen werden. Es muss in einem Atemzug mit Primo Levi, Jorge Semprun oder Imre Kertész genannt werden."(Marius Meller, Tagesspiegel)