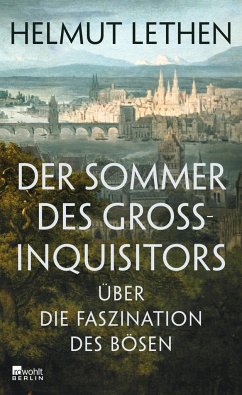Helmut Lethen stößt auf eine Gestalt, die ihn in den Bann zieht: den Großinquisitor, der in der gleichnamigen Legende Dostojewskis den auf die Erde zurückgekehrten Jesus wie die Häretiker auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen will. Diese Verkörperung des Bösen wird zum Ausgangspunkt und Begleiter, wenn Lethen den Bogen schlägt von den Schwarzen Messen des Fin de Siècle über den Kult des Bösen in den historischen Avantgarden und die französischen «Salonnihilisten» bis in unsere Gegenwart. Denn siehe da: Der Großinquisitor geistert durch die Schriften der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, als Denkfigur der Realpolitik bei Max Weber, als regelrechtes Idol bei Carl Schmitt und bei Helmuth Plessner. Noch in Arthur Koestlers Renegaten-Roman «Sonnenfinsternis» tritt eine Art Inquisition auf und mit ihr das Grauen der Verfolgung politischer Gegner in der Sowjetunion. Wo immer der Großinquisitor auftaucht, wird in Lethens bestechenden Lektüren nicht nur das kalte, moralbefreite Denken erfahrbar, sondern auch die dahinterstehenden historischen Verwerfungen und Brüche.
Ein meisterhafter Essay über Macht und Moral - und ein aufregender Ritt durch die Literatur, Philosophie und Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Ein meisterhafter Essay über Macht und Moral - und ein aufregender Ritt durch die Literatur, Philosophie und Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Kampf der Ideologien:
Helmut Lethen verfolgt das Nachleben von Dostojewskis Parabel vom Großinquisitor.
Von Sonja Asal
Auch wer Dostojewskis Roman "Die Brüder Karamasow" nicht gelesen hat, kennt oft die Parabel vom Großinquisitor, die der aufgeklärte und atheistische Iwan seinem frommen Bruder Aljoscha erzählt. Sie spielt in Sevilla zur Zeit der Inquisition. Während die Scheiterhaufen brennen, geht eine Gestalt über den Marktplatz, heilt einen Blinden und erweckt ein Kind zum Leben. Schnell wird klar, dass es sich dabei um den wiedergekehrten Christus handelt. Als der Großinquisitor davon hört, lässt er ihn als Ketzer verhaften. Am Abend, bevor Christus hingerichtet werden soll, kommt der Großinquisitor zum Verhör in seine Zelle. Warum er gekommen sei und die Ordnung störe, die die Kirche etabliert habe, will der Großinquisitor wissen. Und verrät ihm das Geheimnis ihrer Macht: Sie sei nicht mehr mit ihm, Christus, sondern mit dem Teufel im Bund. "Das ganze Unglück Europas rührt daher", zitiert Helmut Lethen in "Der Sommer des Großinquisitors" einen Brief Dostojewskis aus dem Jahr 1870, dass die "römische Kirche Christus verlor und sich dann entschied, auch ohne Christus auszukommen".
Lethens Buch verfolgt das Nachleben der Parabel durch Denken und Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts, durch die Erfahrungen von Gewalt und Sinnverlust, die die Epoche prägten. Zwei Sommer brachte er mit der Lektüre der russischen Klassiker und der "großen Depressiven" zu, mit Dostojewski, Joris-Karl Huysmans und Michel Houellebecq. Und dennoch, so stellt er gleich zu Anfang fest, ist das Resultat "kein fatalistisches Buch". Das liegt vor allem an der abgeklärten Distanz, die Lethen nicht nur gegenüber einigen sein ganzes intellektuelles Leben lang immer von Neuem behandelten Autoren aufbringt, sondern mit der er eigene Erinnerungen und Erfahrungen in sein Schreiben aufnimmt. Auch wenn der Untertitel etwas anderes suggeriert: Eine Faszinationsgeschichte des Bösen bietet das Buch nicht durchweg. Eher handelt es von der Faszination der großen ideologischen Kämpfe, die das vergangene Jahrhundert aufwühlten.
Das Präludium führt in die Zeit des Fin de siècle, in dem die Großinquisitor-Passage ihren "ersten Resonanzraum" fand und unter dem Eindruck religiöser und sozialer Krisenerfahrungen zum Instrument der Modernediagnose wurde. Schon 1881, ein Jahr nach dem Erscheinen des Romans, wurde die Legende von der okkultistischen Schriftstellerin Helena Blavatsky ins Englische übersetzt und in der Zeitschrift der theosophischen Gesellschaft veröffentlicht. In deutscher Sprache zählt Lethen zwischen 1914 und 1964 nicht weniger als dreißig separate Ausgaben. Vor allem im Lauf dieses halben Jahrhunderts wurde die Parabel als das gelesen, was für Lethen im Zentrum seines Interesses steht: als ein der "Rechtfertigung der Gewaltarchitektur" gewidmeter "Herrschaftstraktat".
Lethen setzt an bei Max Webers Rede "Politik als Beruf", mit der dieser im Januar 1919 vor dem Eindruck der Münchner Räterepublik mit der Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik "gegen die moralische Leidenschaft der Aufständischen" anredet und vor dem Umschlagen der wohlmeinenden Gesinnung in Gewalt mahnt. Webers Einsicht, dass "wer mit der Politik, das heißt, mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einlässt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt", ist die Matrix, an der entlang sich Lethens differenzierte Überlegungen entfalten. Bei Georg Lukács findet er Spuren einer an Dostojewski orientierten "Ethik der Güte", Helmuth Plessner definiert in den "Grenzen der Gemeinschaft" mit dem Großinquisitor die "Dreckslinie" der Politik am Rande der moralischen Skrupel.
Schließlich taucht in Carl Schmitts Theorie "der eiskalte, vom Volk isolierte Großinquisitor" als "Galionsfigur" auf. Lethen misstraut allerdings Schmitts ausgestelltem kalten Machtkalkül und liest ihn als Theoretiker, der die Großinquisitor-Konstellation mit dem Intensitätsempfinden des politischen Existenzialismus auflädt. Lethen stellt klar, dass er im Gegensatz zu vielen anderen nicht gewillt ist, Schmitt für den "Morgenstern der Politischen Philosophie" zu halten. Vielmehr kommt er zu einem Urteil, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt: Die Leerstelle in der Freund-Feind-Beziehung, die sich theoretisch in den Zwanzigerjahren geöffnet hatte, habe Schmitt nach 1933 mit Antisemitismus aufgefüllt.
Fast symmetrisch schildert Lethen die Versuchung, einen Bund mit der Macht einzugehen und Gewalt dialektisch wegzudeuten, als eine Erfahrung, die in der Zeit der Totalitarismen auf allen politischen Seiten geteilt wurde. So konnte der Großinquisitor auch zur Reflexionsfigur des kommunistischen Engagements werden. Albert Camus' "Der Mensch in der Revolte" ist für Lethen eine sehr treffende "Geschichte von Europas Hochmut" und Kritik an der französischen Linken. Die wollte wiederum von Arthur Koestlers "Sonnenfinsternis" so wenig wissen, dass die Kommunistische Partei 1946 angeblich die gesamte erste Auflage des Buchs aufkaufen und einstampfen ließ.
Mit der Erschöpfung der großen Ideologien könnte das Buch enden, und Lethen bilanziert entsprechend: "Die Faszination des monotheistisch Bösen, die sich an politische, militärische oder religiöse Gehäuse klammert, hat ausgedient." Doch gelangt er an diesen Punkt über einen überraschenden Umweg. Diesen schlägt er mit Michail Bulgakows Roman "Der Meister und Margarita" ein, in dem sich nicht nur eine realitätsvolle Schilderung des Moskauer Alltagslebens in der stalinistischen Diktatur findet, sondern der nach Lethens Einschätzung "eine der ergreifendsten Darstellungen der Passion Christi" in der gesamten Weltliteratur enthält. Die körperlich Leidenden sind bei ihm die Gegenfiguren zum Großinquisitor.
Lethen berichtet, wie Dostojewski 1867 beim Besuch des Basler Kunstmuseums Hans Holbeins Gemälde "Der tote Christus im Grab" sah, dessen naturalistische Darstellung des körperlichen Verfalls jede Hoffnung auf eine Auferstehung zunichtemacht. Dostojewski greift das Bild in seinem Roman "Der Idiot" auf, wo die Hauptfigur, Fürst Myschkin, beim Anblick des Bildes ausruft: "Vor diesem Bild kann manchem der Glaube verlorengehen."
Mit dem "Idioten" endet Lethens gedankenfunkelnde Darstellung in einem nachdenklichen und gelassenen Ton, mit dem Ausgeliefertsein an das Schicksal der Körperlichkeit und mit Nietzsches Feststellung von der "idiotischsten aller Unfähigkeiten", dem "Nicht-Feind-sein-Können". Auch eine Antwort auf das Rätsel, mit dem die Parabel vom Großinquisitor schließt. Denn nachdem sich Christus die Rede des Großinquisitors wortlos angehört hat, öffnet dieser ihm die Tür und fordert ihn zum Gehen auf, um niemals wiederzukommen. Christus steht auf, küsst den greisen Großinquisitor auf die Lippen und verlässt seine Zelle.
Helmut Lethen: "Der Sommer des Großinquisitors". Über die Faszination des Bösen.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2022. 240 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Helmut Lethen konnte nicht ahnen, wie aktuell sein neues Buch scheinen würde, das in der Corona-Pandemie entstand und sich mit einer Episode aus Dostojewskis "Die Brüder Karamasow" beschäftigt, leitet der Politikwissenschaftler Claus Leggewie seine Rezension ein. Das ist auch als Entschuldigung zu lesen, denn für den Rezensenten hat die Wirklichkeit des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Thesen des Kulturwissenschaftlers überholt. Trotzdem liest Leggewie interessiert, wie Lethen das von Dostojewski fantasierte Treffen des Teufels mit Jesus als Pole der Herrschaftsstruktur bis ins 20. Jahrhundert beschreibt und welche klugen Köpfe sich sonst noch mit dem Motiv des Großinquisitors in dem Roman auseinandergesetzt haben. Leider hat Lethen unerwähnt gelassen, schreibt Leggewie, dass Dostojewski als Publizist eine zerstörerische Politik Russlands und dessen Aversion gegen den Westen unterstützte - was angesichts von Wladimir Putins Propaganda erschrecken lässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Helmut Lethens Buch geht der Faszination des Bösen nach und spannt auf brillante Weise einen Bogen zwischen dem Werk Dostojewskis und der Gegenwart. Neue Zürcher Zeitung 20230116
Rezensent Johan Schloemann läuft es beim Lesen von Hemut Lethens Essay kalt den Rücken runter. Auch wenn der Kulturwissenschaftler nichts explizit macht, weiß Schloemann, dass es hier um Russland und die Neue Rechte in Deutschland geht, der Lethens Frau angehört. In den "Brüdern Karamasow" erzählt Dostojewski die Legende von einem Großinquisitor, der sogar Jesus auf den Scheiterhaufen gebracht hätte, weil dieser "schwächliche Rebell" die Ordnung gestört hätte, die die Kirche auf "Wunder, Geheimnis und Autorität" gegründet habe. Lethen liest die Legende als Blaupause zur Rechtfertigung der Skrupellosigkeit, derzufolge nur die Negation der Moral zum Erfolg führt und die nur zu bereitwillig von etlichen Intellektuellen in Russland und Deutschland aufgegriffen wurde. Schloemann versteht und schaudert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH