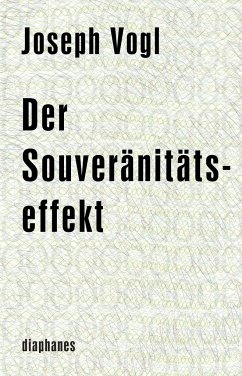Wirtschaftskrisen bieten die Chance zur Realisierung des politisch Unbequemen, formulierte Milton Friedman einmal. Die Finanzkrise hat in ihrer jüngsten Zuspitzung zu einer unverkennbaren Krise des Regierens geführt, zu einer Notstandspolitik in der Grauzone zwischen Wirtschaft und Politik: Die Regierungsgeschäfte haben Expertenkomitees, improvisierte Gremien und 'Troikas' übernommen, deren Legitimation der Ausnahmefall ist.
Diese Entwicklung ist allerdings keineswegs neu. Wie Joseph Vogl in seinem neuen Buch zeigt, sind die Dynamiken des kapitalistischen Systems und des Finanzkapitalismus durch eine Ko-Evolution von Staaten und Märkten geprägt, in der sich wechselseitige Abhängigkeiten etablieren und verstärken. Vom frühneuzeitlichen Fiskus und dem Auftritt des privaten Financiers über die Entstehung von Zentralbanken hin zur Herrschaft von Finanzökonomie und »global governance« zeichnen sich Souveränitätsreservate eigener Ordnung ab, die autonom innerhalb der Regierungspraxis wirken und im Interesse privater Reichtumssicherung die Geschicke unserer Gesellschaften bestimmen: als ungenannte Vierte Gewalt im Staat.
Die aktuelle Dominanz von Finanzmärkten wird so als jüngste Spielart einer Ökonomisierung des Regierens begriffen, in der die Verschränkung von Machtausübung und Kapitalakkumulation informelle 'Souveränitätseffekte' erzeugt.
Diese Entwicklung ist allerdings keineswegs neu. Wie Joseph Vogl in seinem neuen Buch zeigt, sind die Dynamiken des kapitalistischen Systems und des Finanzkapitalismus durch eine Ko-Evolution von Staaten und Märkten geprägt, in der sich wechselseitige Abhängigkeiten etablieren und verstärken. Vom frühneuzeitlichen Fiskus und dem Auftritt des privaten Financiers über die Entstehung von Zentralbanken hin zur Herrschaft von Finanzökonomie und »global governance« zeichnen sich Souveränitätsreservate eigener Ordnung ab, die autonom innerhalb der Regierungspraxis wirken und im Interesse privater Reichtumssicherung die Geschicke unserer Gesellschaften bestimmen: als ungenannte Vierte Gewalt im Staat.
Die aktuelle Dominanz von Finanzmärkten wird so als jüngste Spielart einer Ökonomisierung des Regierens begriffen, in der die Verschränkung von Machtausübung und Kapitalakkumulation informelle 'Souveränitätseffekte' erzeugt.

Der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl sucht die Wurzeln neoliberalen Übels und vergisst dabei einige Kleinigkeiten
Wenn die Ergebnisse einer kleinen wissenschaftlichen Disziplin, in diesem Fall der Wirtschafts- und Finanzgeschichte, in einem anderen disziplinären Kontext großes Gewicht erlangen, ist das erfreulich. Und in der Tat, die Argumentation im soeben erschienenen Buch des Literaturwissenschaftlers Joseph Vogl ist weitgehend zumindest wirtschaftshistorisch inspiriert, auch wenn es nicht von wirtschafts- und finanzgeschichtlichen Fragen im eigentlichen Sinn handelt. Das Buch ist vielmehr zeitdiagnostisch angelegt. Vogl geht es um nicht weniger als die Aufdeckung der Ursachen der gegenwärtigen Finanzmalaise, die für ihn Ausdruck eines (neo-)liberalen Wahns ist, der mit der Konstitution der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung ursächlich verknüpft ist.
Diese bekannte Gedankenfigur geht nicht zu Unrecht davon aus, dass die Entstehung und Durchsetzung des Institutionensets der gegenwärtigen Wirtschaft in maßgeblicher Weise von der im achtzehnten Jahrhundert sich herausbildenden ökonomischen Semantik bestimmt wurde. Sie freilich ist für Vogl nicht ein unbestrittener Fortschritt ökonomischen Wissens, sondern letztlich Camouflage der realen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse, die hinter den Erzählungen von der Trennung von Politik und Wirtschaft, der Souveränität des Staates und der Effizienz der Märkte bloß verborgen werden. Denn weder gebe es heute eine umfassende staatliche Souveränität noch eine klare Trennung von Politik und Wirtschaft, die im Gegenteil stets durch "seignioriale Akteure", vor allem Bank- und Finanzhäuser, miteinander verknüpft gewesen seien.
Diese Akteure, namentlich die seit dem späten sechzehnten Jahrhundert entstehenden Zentralbanken, nun bilden einen der wesentlichen Gegenstände von Vogls Argumentation. Sie hätten stets, als "Zwänge des Markts" verbrämt, die Logik partikularer Interessen vertreten, ja seien in ihrer teils staatlichen, teils privaten Struktur geradezu deren institutioneller Ausdruck. Die Bank von England und die Federal Reserve, die in der Tat eine eigentümliche Kombination von öffentlichem und privatem Eigentum bilden, stehen in Vogls Argumentation hierfür, vor allem dann aber die Bundesbank, die für ihn der geradezu kristalline Ausdruck der Logik des Marktes in Gestalt einer öffentlichen Institution war - und deren Erbschaft sich in der EZB finde.
Diese Akteure hätten einen wesentlichen Teil der Finanzierung des Staates nicht nur kontrolliert, sondern auf diese Weise den Staat in die Logik des Marktes hineingezogen, der gegenüber er gerade nicht souverän gewesen sei. Durch die Liberalisierung der Finanzmärkte seit den siebziger Jahren seien die "seignioralen Akteure" - zu ihnen rechnet Vogl etwa 150 Konzerne - schließlich jeder Kontrolle entglitten. Entstanden sei ein unkontrollierter und unkontrollierbarer "Finanzialisierungskomplex". Die Gegenwart lebe in einer Art "Gefängnis des Marktes", die Demokratie bilde nur noch den Rahmen des politischen Handelns, dessen Substanz sich unter dem Diktat der Finanzmärkte längst der öffentlichen Deliberation und der demokratischen Entscheidung entzogen habe. Die "Finanzialisierung" der Welt wird von Vogl als umfassender Vorgang beschrieben: Keine Region der Welt, kein Handlungsfeld sei ihr entzogen.
Auch wenn Vogls Darstellung in manchen Punkten nicht schlüssig (Bedeutung der Bundesbank für die Finanzierung der Bundesrepublik), sprunghaft (das achtzehnte und das neunzehnte Jahrhundert mit ihrer überaus interessanten Geschichte der öffentlichen Finanzen kommen faktisch nicht vor) und selektiv ist (so werden etwa bezüglich der lateinamerikanischen Schuldenkrise nur die ins Bild passenden Fälle besprochen): das zentrale Argument von der Abhängigkeit der Politik von der Funktion der Finanzmärkte und der damit gegebenen Unterminierung demokratischer Entscheidungsprozesse ist nicht von der Hand zu weisen.
Zahlreiche Autoren haben es in letzter Zeit verwendet, erinnert sei nur an Colin Crouch oder Wolfgang Streeck, die ähnlich wie Vogl eine Auslieferung der demokratischen Prozeduren an arkane Institutionen beklagen. Vogl argumentiert erstaunlich nüchtern. Er ist nicht an Empfehlungen interessiert. Die Lage sei vielmehr aussichtslos; politisch zu ändern, so zumindest der Eindruck nach der Lektüre, ist sie nicht. Insofern kann man Vogl auch nicht vorwerfen, das Buch zeige zu dem geschilderten Verhängnis keine Alternativen; im Grunde gibt es, folgt man der Argumentation bis zum Schluss, nur revolutionäre oder eskapistische Auswege.
Allerdings: Was ein Resultat der wirtschafts- und finanzhistorischen Entwicklung ist, nämlich die zumindest teilweise Abhängigkeit der öffentlichen Finanzen von den privaten Finanzakteuren, wird bei Vogl und anderen Autoren zur Ursache der Entwicklung gemacht. Das aber ist historisch falsch, und hier ist die nur punktuelle Heranziehung von Ergebnissen der wirtschaftshistorischen Forschung dann doch ein Problem. Es war eben nicht eine Art (neo-)liberale Verschwörung, die seit den siebziger Jahren - und bei Vogl im Grunde schon seit dem siebzehnten Jahrhundert - die Welt aus den Angeln gehoben hat. Die ältere Finanzgeschichte lässt sich im Gegenteil als ein Akt der Emanzipation von fürstlicher Willkür beschreiben.
Die neuen Zentralbanken waren nicht nur, ja nicht einmal vorrangig Agenten unterstellter Marktlogiken; sie waren vor allem wirksame Beschränkungen fürstlicher Misswirtschaft, deren Souveränität, sofern sie auf eine Ausplünderung des Landes hinauslief, von dessen Vertretern in den Parlamenten und ständischen Vertretungen gerade bestritten wurde. Die Durchsetzung der politischen Souveränität des Volkes oder zumindest von Teilen davon, im Zweifel im Bürgerkrieg, war ein Kampf gegen fürstliche Allmachtsphantasien, der vor allem ums Geld geschlagen wurde. Die moderne Finanzarchitektur mit geregelter Steuer- und Schuldenorganisation und kalkulierbarer Belastung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit war und ist damit gerade Ausdruck demokratischer Souveränität und - so hätte es ein keineswegs liberaler Autor des achtzehnten Jahrhunderts wie Adam Smith genannt - der Vernunft.
Historisch gesehen, stand die Unabhängigkeit mancher (keineswegs aller!) Zentralbanken nicht am Anfang von deren Geschichte, sondern entsprechende gesetzliche Regelungen dienten der Abwehr staatlicher Maßlosigkeit. Denn mit der Entstehung und Verbreitung des Papiergeldes konnte plötzlich die öffentliche Geldschöpfung über politisch abhängige Zentralbanken (die Geldpresse) hemmungslos genutzt werden - und sie wurde es auch mit zumeist verheerenden inflationären Folgen, an deren Ende die Enteignung der Bevölkerung stand.
Das gilt für Frankreich und Österreich in den Napoleonischen Kriegen; das gilt insbesondere für Deutschland nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Die Reichsbank war bis 1945 eben nicht unabhängig von politischen Weisungen. Adenauer, nebenher, hätte die neue Bundesbank auch gerne unter politische Kuratel gestellt, doch konnte er sich zum Glück nicht durchsetzen.
Wenn sich historisch etwas sicher sagen lässt, dann ist es die Neigung der jeweiligen Obrigkeiten oder Staaten, mehr Geld auszugeben, als sie haben. Es liegt deshalb im Interesse des Souveräns, des Volkes, diese Neigung zu beschneiden und auf ein vernünftiges Maß zu beschränken. Gerade weil die Architektur der Finanzmärkte die staatliche Finanzwirtschaft derart restringiert, ist es ja zur Schuldeneskalation und der Auslieferung von Teilen der staatlichen Handlungsfähigkeit an Finanzmarktakteure gekommen. Es war, nehmen wir nur den deutschen Fall, seit den späten sechziger Jahren eben sehr viel leichter, politische Projekte durch Schulden als durch Steuererhöhungen voranzutreiben, und zwar nicht allein wegen des zu erwartenden politischen Widerstands, sondern auch, weil man zu Recht in hohen Steuern ein ökonomisches Problem vermutete.
Seither lässt sich in Deutschland ein Prozess der Schuldenkumulation (jeweils aus durchaus nachvollziehbaren Gründen) beobachten, der das Land schließlich von der Finanzierungsbereitschaft der in der Tat global gewordenen Finanzmärkte abhängig macht. Und was für Deutschland gilt, gilt für andere Länder noch sehr viel mehr. Letztlich war es die Politik, die sich den Finanzmärkten so ausgeliefert hat, dass ihr nach 2008 scheinbar gar nichts anderes übrigblieb, als diese um jeden Preis zu stabilisieren.
Nicht irgendeine (neo-)liberale Verschwörung war es mithin, welche die Finanzmärkte entfesselt hat, sondern eine Politik, die sich ihnen auslieferte. Gerade das macht es ja auch so schwer, nun zu einer Änderung zu gelangen, da es eben nicht genügt, Finanzmarktakteure zu kontrollieren, von deren unkontrollierter Leistungsfähigkeit die Politik ihrerseits abhängt. Was heute die Lage bestimmt, ist kein "regulatorischer Kapitalismus", sondern im Gegenteil die zumindest punktuelle Suspendierung der kapitalistischen Logik der Selbstkontrolle auf den Finanzmärkten durch das ominöse "too big to fail".
Vogl beklagt eine außer Kontrolle geratene (neo-)liberale Konstellation. Aber es ist gerade das konkrete staatliche Handeln gewesen, das sich hinter Argumentationen wie der von Joseph Vogl sogar noch verstecken kann und das auch tut. Denn gerade aus dieser Ecke werden die Forderungen nach einem Ende der vermeintlichen Austeritätspolitik immer lauter, also nach einem Weiterdrehen an der Schuldenschraube, das ja erst die Lage geschaffen hat, in der sich die Weltwirtschaft derzeit befindet. Vogls Buch, so treffend es viele Momente der Gegenwart beschreibt, zäumt daher letztlich das Pferd von hinten auf. Die Lage ist keineswegs ausweglos, und Europa befindet sich nicht am Vorabend eines großen Krieges. Es kommt vielmehr darauf an, politischer Vernunft das Wort zu reden.
WERNER PLUMPE
Joseph Vogl: "Der Souveränitätseffekt". Diaphanes Verlag, Zürich 2015. 320 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Alexander Cammann findet Joseph Vogls neuestes Buch nicht nur einseitig, sondern in letzter Konsequenz sogar gefährlich. Vogl beschreibt in "Der Souveränitätseffekt" die Verbrüderung von Staat und Wirtschaft im siebzehnten Jahrhundert, deren innige Beziehung, die seither in und außerhalb der sich wandelnden Institutionen fortbestanden habe und die nur scheinbare Ohnmacht einer Politik, die sich im Geheimen die Steuerung längst mit der Wirtschaft teile, während sie in der Öffentlichkeit ein Drama zwischen Abhängigkeit und Opposition aufführe, fasst der Rezensent zusammen. Letzten Endes führe das nicht nur zu einer "Delegitimierung der Neuzeit" im Ganzen, warnt Cammann, es ignoriere auch die ausdifferenzierten Machtverhältnisse zugunsten der Dichotomie von Herrschern und Beherrschten, kritisiert der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wer ist der Souverän im modernen Staat? Indem er detektivisch den historischen Voraussetzungen der aktuellen Finanz- und Haushaltskrisen und dem Zusammenspiel von Finanzmärkten und Regierungshandeln nachspürt, gibt Joseph Vogl eine politisch brisante Antwort.« Jury »Preis der Leipziger Buchmesse«