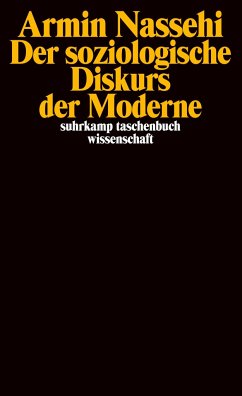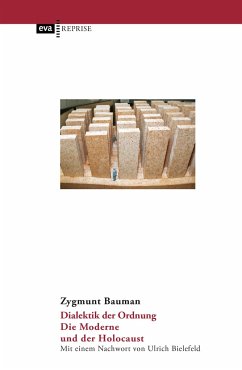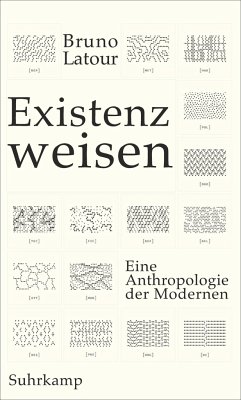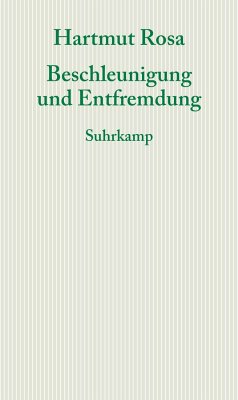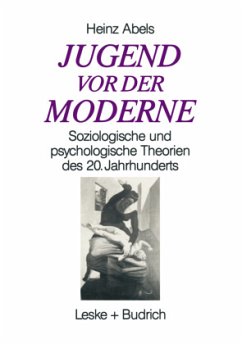Nicht lieferbar

Der soziologische Diskurs der Moderne
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Wie funktioniert eigentlich die Soziologie? Vor welchem Publikum bewährt sie sich? Wie konstruiert sie ihren Gegenstand? Und welche Probleme löst sie, die wir ohne sie nicht hätten? Diese Fragen zielen auf die Möglichkeit soziologischer Theorie und Forschung überhaupt.Die Antwort, die hier gegeben wird, besteht weder in einer Geschichte noch in einer systematischen Darstellung der Soziologie. Es geht vielmehr um eine Kritik der soziologischen Vernunft. Das zentrale Verfahren ist daher das der klassischen (Erkenntnis-)Kritik - einer Kritik, die die Bedingungen auslotet, mit denen sich sozi...
Wie funktioniert eigentlich die Soziologie? Vor welchem Publikum bewährt sie sich? Wie konstruiert sie ihren Gegenstand? Und welche Probleme löst sie, die wir ohne sie nicht hätten? Diese Fragen zielen auf die Möglichkeit soziologischer Theorie und Forschung überhaupt.
Die Antwort, die hier gegeben wird, besteht weder in einer Geschichte noch in einer systematischen Darstellung der Soziologie. Es geht vielmehr um eine Kritik der soziologischen Vernunft.
Das zentrale Verfahren ist daher das der klassischen (Erkenntnis-)Kritik - einer Kritik, die die Bedingungen auslotet, mit denen sich soziologisches Denken möglich macht. Neben einer Kritik der reinen Soziologie geht es auch um eine Kritik der handelnden, der authentischen, der operativen und der gesellschaftlichen Vernunft. Diese Rekonstruktion kann keine neutrale Beobachtung des Faches sein, sondern führt zu einem Konzept einer Gesellschaft der Gegenwarten. Es soll den veränderten Bedingungen einer Gesellschaft Rechnung tragen, die selbst nicht mehr an die Konstruktionen jener soziologischen Vernunft glaubt, welche das klassische Bild der (bürgerlichen) Gesellschaft und ihrer soziologischen Weiterentwicklung gezeichnet hatte.
Die Antwort, die hier gegeben wird, besteht weder in einer Geschichte noch in einer systematischen Darstellung der Soziologie. Es geht vielmehr um eine Kritik der soziologischen Vernunft.
Das zentrale Verfahren ist daher das der klassischen (Erkenntnis-)Kritik - einer Kritik, die die Bedingungen auslotet, mit denen sich soziologisches Denken möglich macht. Neben einer Kritik der reinen Soziologie geht es auch um eine Kritik der handelnden, der authentischen, der operativen und der gesellschaftlichen Vernunft. Diese Rekonstruktion kann keine neutrale Beobachtung des Faches sein, sondern führt zu einem Konzept einer Gesellschaft der Gegenwarten. Es soll den veränderten Bedingungen einer Gesellschaft Rechnung tragen, die selbst nicht mehr an die Konstruktionen jener soziologischen Vernunft glaubt, welche das klassische Bild der (bürgerlichen) Gesellschaft und ihrer soziologischen Weiterentwicklung gezeichnet hatte.