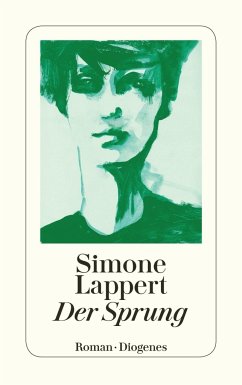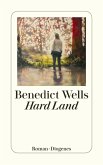Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich herunterzukommen. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei riegelt das Gebäude ab, Schaulustige johlen, zücken ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere Menschen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt - oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit.

Ein großartig geschriebenes, besonderes Buch, mit ganz besonderen Menschen aus unser aller Alltag.
© BÜCHERmagazin, Manuela Haselberger (has)
Keiner weiß, warum die junge Frau oben auf dem Dach des Wohnhauses steht und mit niemandem sprechen will. Manchmal wirft sie aus lauter Wut Dachziegel in die neugierig gaffende Menge, die es sich auf Decken gemütlich gemacht hat, um bloß nicht mit ihrem Handy den Zeitpunkt zu versäumen, wenn die Frau tatsächlich springt. Immer wieder geht sie an die Dachkante und schaut in den Abgrund. So beginnt der zweite Roman der Schweizerin Simone Lappert, geb. 1985 in Aarau. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven schildert die Autorin die kommenden Tage und alle Personen, die zu Wort kommen, haben auf irgendeine Weise mit Manu, der Frau auf dem Dach, zu tun. Für den Leser ist zu Beginn nicht ganz klar, wie er die unterschiedlichen Stimmen zuordnen soll, doch im Laufe der Lektüre ergibt sich das Gesamtbild. Hilfreich dabei: Der jeweilige Erzähler wird immer in der Kapitelüberschrift genannt. Simone Lappert schildert auf sehr eindrucksvolle Weise die Stimmung in Thalbach, einer Kleinstadt in der Nähe von Freiburg. Da gibt es Obdachlose, die ihr Haus verloren haben, alte Menschen, die in einem Heim leben, Schülerinnen, die gemobbt werden. Und nicht nur die Stimmung einer Kleinstadt erlebt der Leser, die Personen bei Simone Lappert sind überaus lebensecht getroffen.
Ein großartig geschriebenes, besonderes Buch, mit ganz besonderen Menschen aus unser aller Alltag.
Ein großartig geschriebenes, besonderes Buch, mit ganz besonderen Menschen aus unser aller Alltag.