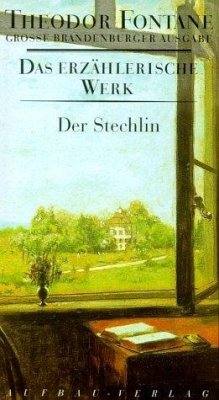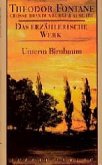"Hohe, heitere und wehe, das Menschliche auf eine nie vernommene, entzückende Art umspielende Lebensmusik sind diese Plaudereien ..."Thomas MannEines der schönsten Bekenntnisbücher der deutschen Literatur erstmals in authentischer TextgestaltDie sich da zu Plauderstunden auf dem altmodischen märkischen Gut zusammenfinden, wissen um die Gefahren seelischer und geistiger Erstarrung. Allen voran der liebenswürdige Dubslav von Stechlin, aber auch sein Sohn Woldemar, die geheimnisvolle Gräfin Melusine und deren stille Schwester Armgard sind davon überzeugt: Wer Zukunft gewinnen will, muß aus der Enge heraus.In diesem Sinne ist der sagenumwobene Stechlinsee ihr bewundertes Vorbild, hat er doch Fühlung mit der großen Welt. An die Stelle herkömmlicher Handlung treten die beziehungsreichen Gespräche einer Gruppe sympathischer Gestalten. In der reizvollen Szenerie märkischer Ortschaften wie am Berliner Kronprinzenufer begegnen sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteren, Anschauungen und Verhaltensweisen, die der Erzähler in seiner unnachahmlichen Dialogführung teils humoristisch-komisch, teils karikierend in Erscheinung treten läßt.Der Kommentar bewältigt ein immenses Material. Die breite zeitgenössische Wirkung des Romans, die Fülle der überlieferten Handschriften, der Reichtum an Fakten und Anspielungen verlangen dem Herausgeber alles ab. Durch die Heranziehung zeitgeschichtlichen Materials wie der Reden von Bismarck und Wilhelm II. wird die politische Dimension des Romans schlüssig nachgewiesen.Herausgegeben von Klaus-Peter Möller

Die Neuausgabe von Fontanes "Stechlin" · Von Alexander Honold
Schon vor hundert Jahren hat man den "Stechlin" als eine Art Staatsvermächtnis gelesen, als ein politisches Zeitgemälde in der Form des Konversationsromans. Nimmt sich der Leser im Winter des Jahres 2001 den Roman aus Anlaß der vorzüglichen Neuedition im Rahmen der Brandenburger Ausgabe vor, so erwartet ihn bereits in der feierlichen Einleitung ein frappantes Vorzeichen des Kommenden. Überraschend kehrt der junge Stechlin zu einem Besuch auf dem Stammsitz im Norden der Grafschaft Ruppin ein und mit ihm die neue Zeit. Da läßt der alte Herr die Fensterflügel in den herbstlich leuchtenden Park öffnen, was bei seiner Empfindlichkeit gegen Zugluft gegen alle Gewohnheit verstößt. "Heute aber war dritter Oktober und ein wundervoller Herbsttag dazu." Mit der nationalen Einführung des "Stechlintags", so schwant uns, könnte auch die Wiederkehr Preußens gelingen.
Mehr als andere späte Früchte der Romankunst Fontanes erwies sich dieses als Werk des rechten Zeitpunktes, den allein der Zufall oder das Leben selbst bestimmt. In der fliegenden Eile weniger Wochen hatte der Fünfundsiebzigjährige den Entwurf niedergeschrieben, dann über Jahre penibel daran gefeilt und verbessert. Schwer hatte "Fontanes Spätling" (Thomas Mann) an der Bürde zu tragen, daß dem Erscheinen der Buchausgabe vom Oktober 1898 das Ableben des Verfassers um wenige Wochen vorausging. Es bedurfte keiner sonderlich subtilen Interpretationskunst, in dem Porträt des märkischen Schloßherrn Dubslav von Stechlin, der am Ende des Romans ebenfalls das Zeitliche segnet, Züge seines Schöpfers zu erkennen. Als standhafter Konservativer tritt er uns entgegen, "aber von der milden Observanz", voller Güte und tapferer Lebenslust.
Warmherziger als jeder Liberale spricht der alte Stechlin vom Fortschritt und von der neuen Zeit. Mit den einfachen Landarbeitern und dem Gesinde steht er auf so vertrautem Fuße, daß ihn der vom fernen Berlin aus agitierende Abgeordnete der Sozialdemokraten darum beneiden müßte, wenn er sich überhaupt einmal blicken ließe. So sind denn, je nach Gusto, höchst unterschiedliche Tendenzen aus dem Roman herausgelesen worden, und alle konnten in diesem vielstimmigen Werk prägnante Zitate und geflügelte Wendungen für sich verbuchen. "Lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht", pflegt etwa Dorfpastor Lorenzen zu sagen, "und mit dem Neuen nur, soweit es irgend muß." Was immer das bedeuten mag, es kommt dem stillen Konsens der Fontane-Gemeinde recht nahe - nicht als Meinung, sondern im Tonfall.
Selbst wer ihnen bei der Lektüre zum ersten Mal begegnet, glaubt diese typischen Sentenzen schon einmal gehört zu haben. Doch geben sie keine Bekenntnisse ihres Autors, sondern den stets ein bißchen überdrehten Konversationston der Zeit wieder. Vorlaut und überdeutlich vernimmt man den Leitartikel-Jargon in der Warnung des Neureichen, der bei jedweder mißliebigen Zeiterscheinung anmerken muß, dies oder jenes sei "Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokraten". Ob dieses Wortes werden wir den aufstrebenden Holzfabrikanten Gundermann ("die Berliner Dielen sind fast alle von uns") nie vergessen. Fontane begnügt sich nicht damit, ihn diese Wendung gebetsmühlenhaft wiederholen zu lassen, er weist den Parvenü selbst als mehrfachen Mühlenbesitzer aus. Man mag derlei Karikaturen im realistischen Erzählwerk ungehörig oder abgeschmackt finden. Aber folgen sie nicht akkurat dem Vorschlag aus Büchners "Danton"-Drama, den Phrasen bis zu jenem Punkte nachzugehen, wo ihre Sprecher sie verkörpern?
Entlang des Gewindes solcher Phrasen "schrauben" Fontanes Figuren einander in Rededuellen, die den Hauptpart der Handlungsführung übernehmen. Einen Mangel an äußerer Aktion hat man dem Roman vorgeworfen und dabei diese indirekte Dramaturgie übersehen, die durch beredtes Parlieren das Wichtigste ungesagt läßt. Als Stilist der aussparenden Andeutung erweist sich Fontane, wenn Woldemar, der junge Herr von Stechlin, den beiden Töchtern des Grafen Barby den Hof macht, indem er artig über seine englischen Reiseeindrücke berichtet. Obwohl der Leser dem Trio nicht von der Seite weicht, trifft ihn höchst unvorbereitet hernach die Mitteilung, in diesem harmlosen Plauderstündchen sei eine Entscheidung gefallen, gar eine Verlobung besiegelt worden.
Nicht anders hält es Fontanes "Stechlin" mit der Politik. Selbst den großen Konflikten der Zeit mitsamt ihren Berliner Parlamentsdebatten nimmt der gesellige Ton die Schärfe. Als der alte Stechlin bei einer Nachwahl zum Reichstag gegen Fortschritt und Sozialdemokratie ins Rennen geht, kippt die vermeintliche Loyalität, wie allerlei Zeichen zu verstehen geben, rasch und unmerklich zugunsten des sozialdemokratischen Kandidaten um. Wieder muß das Entscheidende zwischen den Zeilen geschehen sein, und die präzise Einkreisung dieses unklaren Gefühls macht den "Stechlin" zum Schauplatz des Historischen.
Seinen Geschichtsunterricht erteilt der Roman in Form eines Gesellschaftsspiels. Wie niemand ganz ohne Fehl ist zwischen Rheinsberg und der Reichshauptstadt, trägt auch keiner allein den Tadel. So kann sich der alte Stechlin für die sonderbarsten Charaktere und Bedürfnisse erwärmen, nur nicht für seine eigene Schwester. Diese gebietet als Klostervorsteherin über einige verhärmte Stiftsfräulein, aber nicht über das mindeste Zartgefühl. Ihr gegenüber steht die schönen Gräfin Melusine. Diese hat, kraft ihres Namens den unbändigen Gewässern zugetan, zuviel des Elementaren, um für den jungen Herrn am See eine ratsame Partie zu sein. Enttäuschend, aber folgerichtig entscheidet sich Woldemar für Melusines jüngere Schwester Armgard, die ihm, schweigsam und gutherzig, vom Naturell her weit näher steht.
Überhaupt hat es mit der Generationenfolge (drei Jahre nur fehlen zu "Buddenbrooks") die Bewandtnis, daß sich der trotzige Selbstbehauptungswille der Alten bei den Sprößlingen zu verlieren scheint und mit ihm die Laune am trefflich gesetzten Worthieb, die weiten Pendelschläge ins Generöse wie ins Maliziöse. Das Neue mag seine Berechtigung haben und ohnedies auch die stärkeren Bataillone - aber ist es nicht einfach nur rechtschaffen farblos?
Fontanes "Stechlin" ist nicht zuletzt darum ein prophetisches Werk, weil er das alte Preußen zu Zeiten seiner größten äußeren Pracht- und Machtentfaltung als dahinschwindendes betrauert. Nein, nicht betrauert, sondern öffnet und durchlässig macht für die kommenden Beben der Geschichte. Wie man weiß, bezeichnet "der Stechlin" nicht allein den preußischen Gutsherrn, sondern auch sein Land und den angrenzenden See, in welchem die Erschütterungen und Revolutionen ferner Erdteile hohe Wellen schlagen. Der See und sein Roman sind mit einem seismographischen Gespür für den "großen Zusammenhang der Dinge" begabt. Ihre Domäne ist das Beziehungsreiche, dem sich mit den Mitteln der Chronik oder der Wissenschaft schwerlich beikommen ließe.
Beim Wiederlesen des "Stechlin" ist es nicht allein die unvermutete Zeitnähe seiner entschwundenen Welt, die staunen macht. Eklatant wie nie treten in Klaus-Peter Möllers Ausgabe auch Sperrigkeiten und Torheiten zutage. Denn anders als die bisherige, von Walter Keitel und Helmuth Nürnberger betreute Referenzedition hat sich die "Brandenburger Ausgabe" erstmals die "buchstaben- und zeichengetreue" Wiedergabe der originalen Textgestalt zum Ziel gesetzt. Jeder korrigierende Eingriff wird nachgewiesen, bei Diskrepanzen sind auch abweichende Überlieferungszeugen aufgeführt. Mit ihrem umfassenden Kommentar und ihren konzisen interpretatorischen Hinweisen strebt die Neuedition zugleich den Charakter einer populären Leseausgabe an, ohne die störenden, mitunter geradezu verstörenden Züge des Werkes zu glätten. Oberflächlich befremdet die Schreibung der Erstausgabe durch orthographische Gebilde wie die langgestreckte märkische "Seeenkette". Schwerer wiegen die im Stellenkommentar nachgezeichneten antisemitischen Untertöne, die Fontane etwa der Figur seines jüdischen Geldverleihers mitgegeben hat. Eng am üblen Vorbild von Gustav Freytags "Soll und Haben" angelehnt, will der durchtriebene Geschäftemacher durch Schuldverschreibungen das Gut der alteingesessenen Märker an sich raffen. Auch in der sanften Selbstverständlichkeit, mit der solche Haßbilder einfließen, erweist sich "der Stechlin" als treuer Seismograph.
Auf dem Herrensitz ist "alles schon ziemlich verschlissen", am fadenscheinigsten aber die Flagge in den Hohenzollernfarben Schwarz und Weiß. "So lange ich hier sitze, hält es noch", tröstet sich der Alte. In zweideutiger Voraussicht hindert er den Diener, die Preußenflagge zur Trikolore des wilhelminisch auftrumpfenden Kaiserreichs zu erweitern. Der Wink stammt von einem Skeptiker, der weder dem erstarkten Nationalstaat noch seinen Kritikern das märkische Stammland überlassen möchte. Fontanes doppelte Verneinung des Realpolitischen durchbricht die Schwarzweißmalerei - um den Preis, daß auch sein Textgewebe sich brüchiger darstellt, als das Klischee vom heiteren Alterswerk es wahrhaben will.
Theodor Fontane: "Der Stechlin". Roman. Herausgegeben von Klaus-Peter Möller. Aufbau-Verlag, Berlin 2001. 716 S., geb., 59,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Angesichts "der vorzüglichen Neuedition" dieses fontaneschen Spätwerkes hat Rezensent Alexander Honold den Roman noch einmal gelesen. Der "Stechlin" sei nicht zuletzt deshalb ein "prophetisches Werk", weil er das alte Preußen zu Zeiten seiner größten äußeren Pracht- und Machtentfaltung als "dahinschwindend" betrauere. Beim Wiederlesen machte den Rezensenten besonders "die unvermutete Zeitnähe" der "entschwundenen Welt" des Romans staunen. Für eklatanter allerdings hält Honold dessen "Sperrigkeiten und Torheiten", die in Klaus-Peter Möllers Ausgabe "eklatant wie nie" zu Tage träten. Die "Brandenburger Ausgabe" habe sich die "buchstaben- und zeichengetreue Wiedergabe der originalen Textgestalt" zum Ziel gesetzt. Anders als in Vorgängerausgaben werde jeder korrigierende Eingriff nachgewiesen. Mit "ihrem umfassenden Kommentar und ihren konzisen Hinweisen" strebe diese Neuedition gleichzeitig den Charakter einer "populären Leseausgabe" an, ohne die "mitunter geradezu verstörenden Züge des Werkes zu glätten" - beispielsweise die antisemitischen Untertöne, die Fontane der Figur seines jüdischen Geldverleihers mitgegeben habe. Denn auch in der "sanften Selbstverständlichkeit", schreibt Honold, mit der "solche "Hassbilder" in den Roman einfließen würden, erweise sich der "Stechlin" "als treuer Seismograf".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Mittlerweile macht Fontane süchtig, beinahe. So hat er jetzt eine treue und noch wachsende Gemeinde. Er ist ein Unterhaltungsschriftsteller geblieben und ein Klassiker geworden. Welch ein ungewöhnlicher Triumph für einen Autor, dem man einst das Leichte verübelt, das Anmutige vorgeworfen und das Charmante verargt hat!« Frankfurter Allgemeine Zeitung 20031101