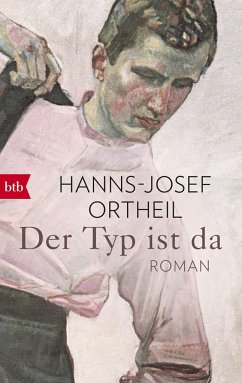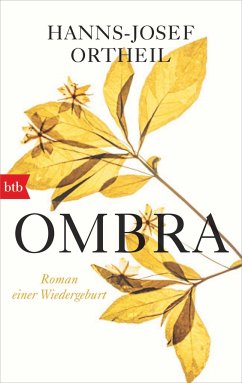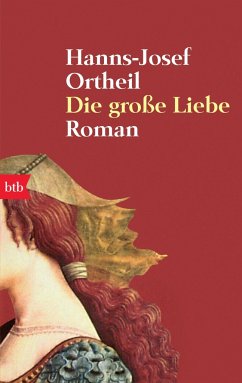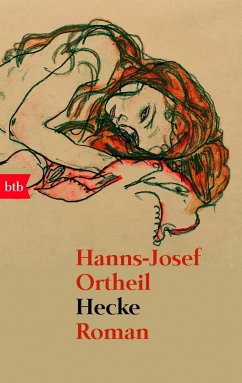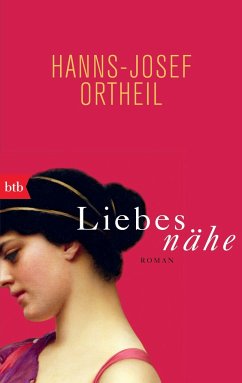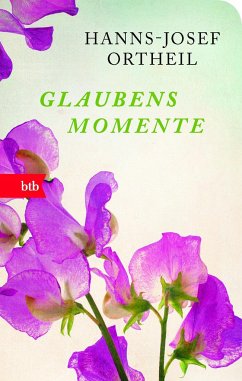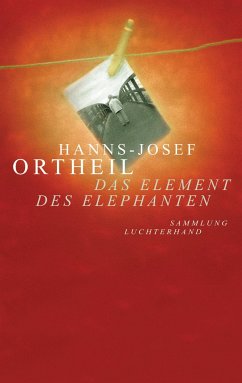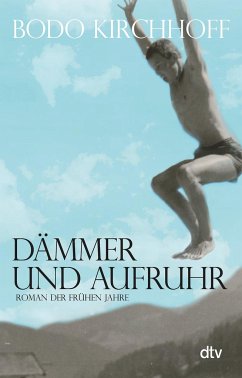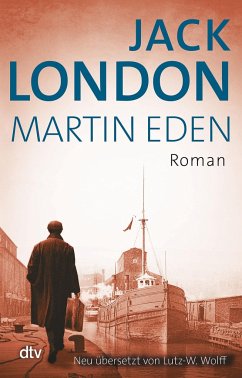Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Seit dem achten Lebensjahr erhielt Hanns-Josef Ortheil von seinen Eltern Schreib- und Sprachunterricht. Sie hatten Angst, dass er Sprechen und Schreiben - nach Jahren des Stummseins - nicht mehr richtig lernen würde. Die »Schreibschule« der Eltern folgte keinen Lehrbüchern oder sonstigen Vorlagen. Sie entstand Tag für Tag spontan aus dem Bild- und Sprachmaterial, das die nahen Umgebungen anboten. Mit den Jahren übernahm der Junge selbst die Regie. Schon bald erschienen seine ersten Kindertexte dann auch in Zeitungen und Zeitschriften. Ein sehr ungewöhnlicher Autor war geboren: »Das Kin...
Seit dem achten Lebensjahr erhielt Hanns-Josef Ortheil von seinen Eltern Schreib- und Sprachunterricht. Sie hatten Angst, dass er Sprechen und Schreiben - nach Jahren des Stummseins - nicht mehr richtig lernen würde. Die »Schreibschule« der Eltern folgte keinen Lehrbüchern oder sonstigen Vorlagen. Sie entstand Tag für Tag spontan aus dem Bild- und Sprachmaterial, das die nahen Umgebungen anboten. Mit den Jahren übernahm der Junge selbst die Regie. Schon bald erschienen seine ersten Kindertexte dann auch in Zeitungen und Zeitschriften. Ein sehr ungewöhnlicher Autor war geboren: »Das Kind, das schreibt.«
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und zuletzt dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Produktdetails
- btb Bd.71529
- Verlag: btb
- Seitenzahl: 384
- Erscheinungstermin: 14. August 2017
- Deutsch
- Abmessung: 187mm x 120mm x 27mm
- Gewicht: 310g
- ISBN-13: 9783442715299
- ISBN-10: 3442715296
- Artikelnr.: 47031992
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
 buecher-magazin.deSeine Autobiografie bildet, mehr oder weniger fiktionalisiert, den großen Stoff seines Œuvre: In der Tat blickt Hanns-Josef Ortheil auf eine außergewöhnliche Kindheit zurück. Der 1951 in Köln geborene Schriftsteller, Pianist und Professor für kreatives Schreiben verstummte im Alter von drei Jahren, erst mit sieben lernte er wirklich sprechen. Mit seinem Schweigen passte er sich der Mutter an, die nach dem Tod von vier Söhnen lange Zeit nur per Notizen kommunizierte. Doch die Eltern befreien den Sohn aus seiner Kapsel. Sie ersinnen eine eigene "Schreibschule", fern jedes Bildungskanons. Zur Ferienzeit dient Vaters Jagdhütte als Werkstatt, zur Schulzeit die Wohnung. Der Vater, ein Vermesser, setzt auf Analyse; die Mutter, eine Bibliothekarin, auf Gefühl und Klavierunterricht. Hanns-Josefs Sprachwerdung basiert auf genauem Hinsehen und Hinhören sowie auf kreativer Lektüre (etwa dem Um- und Fortschreiben von Geschichten). Bald entdeckt die Tagespresse "das Kind, das schreibt". Die Textarbeit wird immer komplexer, der Junge spürt "die Magie des Schreibens". Ein riesiges Archiv entsteht. Es bildet den Fundus für Ortheils freimütig und aus kindlicher Perspektive erzählten Roman über die Geburt eines besessenen Literaten - der einmal einen ganz anderen Traum hatte.
buecher-magazin.deSeine Autobiografie bildet, mehr oder weniger fiktionalisiert, den großen Stoff seines Œuvre: In der Tat blickt Hanns-Josef Ortheil auf eine außergewöhnliche Kindheit zurück. Der 1951 in Köln geborene Schriftsteller, Pianist und Professor für kreatives Schreiben verstummte im Alter von drei Jahren, erst mit sieben lernte er wirklich sprechen. Mit seinem Schweigen passte er sich der Mutter an, die nach dem Tod von vier Söhnen lange Zeit nur per Notizen kommunizierte. Doch die Eltern befreien den Sohn aus seiner Kapsel. Sie ersinnen eine eigene "Schreibschule", fern jedes Bildungskanons. Zur Ferienzeit dient Vaters Jagdhütte als Werkstatt, zur Schulzeit die Wohnung. Der Vater, ein Vermesser, setzt auf Analyse; die Mutter, eine Bibliothekarin, auf Gefühl und Klavierunterricht. Hanns-Josefs Sprachwerdung basiert auf genauem Hinsehen und Hinhören sowie auf kreativer Lektüre (etwa dem Um- und Fortschreiben von Geschichten). Bald entdeckt die Tagespresse "das Kind, das schreibt". Die Textarbeit wird immer komplexer, der Junge spürt "die Magie des Schreibens". Ein riesiges Archiv entsteht. Es bildet den Fundus für Ortheils freimütig und aus kindlicher Perspektive erzählten Roman über die Geburt eines besessenen Literaten - der einmal einen ganz anderen Traum hatte.© BÜCHERmagazin, Ingeborg Waldinger (wal)
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Der nun unter dem Titel "Der Stift und das Papier" erschienene Fortsetzungsroman zu Hanns-Josef Ortheils früherem Buch "Die Erfindung des Lebens" ist wesentlich besser als sein Vorgänger, verspricht Rezensent Burkhard Müller. Denn erfreulicherweise macht der Autor diesmal die autobiografische Prägung der Geschichte deutlich, wodurch das Buch unmittelbarer wirkt, meint der Kritiker. Mit einiger Beklemmung liest er die Geschichte des kleinen Hanns-Josef, der ähnlich wie seine Mutter, die vier Söhne im Krieg verloren hat, das Sprechen verweigert. Zugleich ist der Rezensent fasziniert, wenn er erlebt, wie der Vater das Kind dazu bringt, seine täglichen Erlebnisse aufzuschreiben. Neben den zahlreichen in die Erzählung eingebundenen Originalnotizen des Kindes liest Müller auch nach, wie erdrückend die Liebe der Eltern für den Jungen gewesen sein muss, der sich erst im Alter von elf Jahren ein wenig aus dem elterlichen Kokon befreien kann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ortheil taucht für seinen Roman in das Archiv seiner frühesten Texte ein - und gleitet hinüber in die Sprache des Kindes, das er mal war." Tobias Becker / DER SPIEGEL
Gebundenes Buch
+++Über die Passion des Schreibens+++
"In "Der Stift und das Papier" erforscht er so genau wie bisher in noch keinem seiner Bücher den Prozess des Schreibens."
Heide Soltau / NDR Kultur
Nach dem Erscheinen seines zweiten Kindertagebuchs "Die Berlinreise“ …
Mehr
+++Über die Passion des Schreibens+++
"In "Der Stift und das Papier" erforscht er so genau wie bisher in noch keinem seiner Bücher den Prozess des Schreibens."
Heide Soltau / NDR Kultur
Nach dem Erscheinen seines zweiten Kindertagebuchs "Die Berlinreise“ wurde Hanns-Josef Ortheil häufig gefragt, wie er als Zwölfjähriger ein derart beeindruckendes Buch schreiben konnte. Dieser Frage ist er jetzt in dem Band "Der Sift und das Papier" nachgegangen. Schritt für Schritt wird erzählt, wie er, begleitet und angeleitet von Vater und Mutter, sich das Schreiben beibrachte. Er beschreibt, wie er übte und wie diese Übungen langsam übergingen in kleine Schreibprojekte, die er sich selber ausdachte und verfolgte. Es ist die bewegende Geschichte eines Jungen, der lange Zeit nicht sprach und der einen eigenen Weg zum Sprechen und Schreiben suchen musste. Und es ist bei allen Widerständen, die sich in den Weg stellten, die Geschichte eines Wunderkinds, das früh ein Gefühl für das Erzählen besaß und das über eine Gabe verfügte, die alle anderen überstrahlte: beobachten zu können und das Beobachtete traumwandlerisch in die richtigen Worte zu fassen.
Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Da seine Mutter aufgrund traumatischer Kriegsereignisse (seine vier älteren Brüder kamen ums Leben) an einer Sprachstörung litt, wuchs Ortheil in einer Art autistischer Sprachlosigkeit auf, die sich erst durch den frühen Schreibunterricht seines Vaters langsam behob. Schon im Alter von acht Jahren veröffentlichte Ortheil seine ersten Erzählungen in Tageszeitungen, das Schreiben wurde immer mehr zu einem existentiellen Medium des Überlebens. (Ausführlich hat er diese Jahre seiner frühen Kindheit in dem Buch Das Element des Elephanten. Wie mein Schreiben begann dargestellt.)
Neben der Literatur hatte die Musik für den anfangs Sprachlosen die größte Bedeutung. Er erhielt früh Klavierunterricht und setzt seine pianistische Ausbildung später als Schüler von Daniela Ballek und Claudia Arrau fort. In Wuppertal und im Westerwald aufgewachsen, machte er 1970 in Mainz Abitur und ging danach für längere Zeit nach Rom. Dort finanzierte er sein pianistisches Studium als Organist an einer deutschen Kirche; seit 1970 arbeitete er auch als Film- und Musikkritiker. Nach einem krankheitsbedingten Abbruch seiner pianistischen Laufbahn begann er ein Studium der Musikwissenschaften, Philosophie und Germanistik in Mainz, Rom, Göttingen und Paris, das er 1976 in Mainz mit der Promotion abschloss.
Von 1976 bis 1988 war er Assistent am Deutschen Institut der Universität Mainz, seit 1990 ist er Dozent für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. 1988 war er „Writer in residence“ an der Washington-University in St. Louis/Missouri. In den Jahren 1991 und 1993 verweilte er als Villa Massimo-Stipendiat in Rom. 1993/94 hielt er die Poetik-Vorlesung an der Universität Paderborn und 1994/95 an der Universität Bielefeld. Im Jahre 1998 übernahm er die Heidelberger Poetik-Dozentur. 2002 wurde er in Hildesheim zum Professor berufen. Hanns-Josef Ortheil lebt seit 1982 in Stuttgart.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für