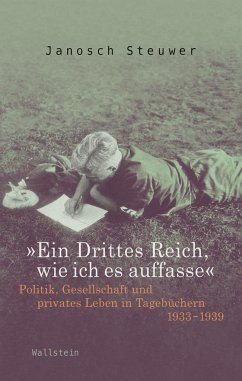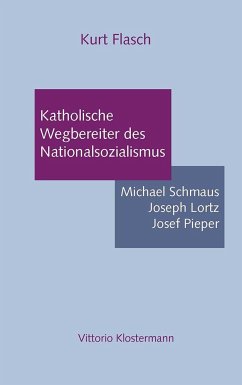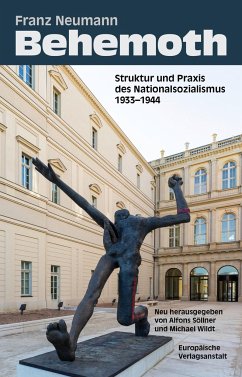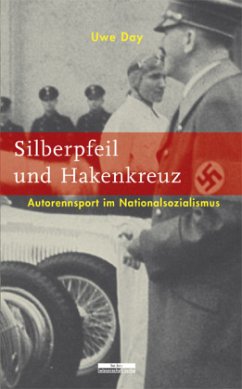Nicht lieferbar

Der stille Bürgerkrieg
Ernst Jünger und Carl Schmitt im Dritten Reich
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
"Carl Schmitt ist in meiner und ich bin in seiner Biographie unvermeidlich", notierte Ernst Jünger am 18. August 1995. Die enge Freundschaft, vor allem aber die sachliche Differenz beider ist bislang nicht hinreichend erforscht. Die Freundschaft begann im Jahre 1930 mit einem ersten Gespräch, bei dem es sofort brisant wurde. Es ging um nichts weniger als das Erkennen der "Lage" und die anspruchsvolle moralische Entscheidung - für Jünger wie Schmitt ein leitmotivisches Thema, das der eine mit mythischen Annäherungen, der andere mit einem konkreten Situationsdenken anging. Doch beide müssen schließlich einräumen, die Lage nicht wirklich erkennen zu können. Ihre Positionen waren schwer vereinbar und hatten sich zu bewähren in einem Bürgerkrieg, der verdeckt geführt wurde und quer zu den offiziellen Fronten verlief. Er spitzte sich für Ernst Jünger wie für Carl Schmitt zur tödlichen Bedrohung zu und forderte Jüngers Sohn als Opfer.
Dieser gedanklich tiefgehende und philologisch sorgfältig gearbeitete Essay ist unverzichtbar für jeden, der sich mit Jünger oder Schmitt beschäftigt.
Dieser gedanklich tiefgehende und philologisch sorgfältig gearbeitete Essay ist unverzichtbar für jeden, der sich mit Jünger oder Schmitt beschäftigt.