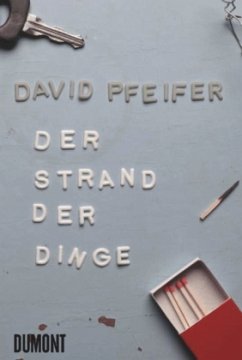Der Aufstieg war rasant, doch der Absturz ging noch schneller und hat einen Karrieristen mit Fragen zurück gelassen: Was bin ich wert, wenn ich nichts verdiene? Wie sage ich es meinen Feinden? Und warum lerne ich beim Verlieren mehr als beim Gewinnen?
Heute verschanzen sie sich in den Cafés von Berlin-Mitte hinter ihren Laptops und nennen sich digitale Boheme , aber kaum jemand erinnert sich daran, dass diese Menschen einmal Arbeit hatten.
David Pfeifer erzählt von der Zeit, als dem Neuen Markt die Unschuld und den Menschen die Jobs verloren gingen. Und davon, wie die Mitte zur Mitte wurde, in Berlin und anderswo. Die Allmachtsphantasien der Senkrechtstarter und die Verteidigungssprüche der Verlierer werden in seinem Roman zu einem Porträt der Krise als Chance.
Heute verschanzen sie sich in den Cafés von Berlin-Mitte hinter ihren Laptops und nennen sich digitale Boheme , aber kaum jemand erinnert sich daran, dass diese Menschen einmal Arbeit hatten.
David Pfeifer erzählt von der Zeit, als dem Neuen Markt die Unschuld und den Menschen die Jobs verloren gingen. Und davon, wie die Mitte zur Mitte wurde, in Berlin und anderswo. Die Allmachtsphantasien der Senkrechtstarter und die Verteidigungssprüche der Verlierer werden in seinem Roman zu einem Porträt der Krise als Chance.

Vor drei Jahren hat David Pfeifer noch ein Loblied auf die digitale Vernetzung verfasst. Jetzt analysiert er in seinem neuen Roman die fatalen Folgen des Goldrauschs in der New Economy.
Wer scheitert, erzählt. Es sei denn, es hat ihm die Sprache verschlagen. Dass innere Verletzung Text in Gang bringt, ist so platt wie wahr. Philip, gefallener Chef einer Internetfirma, wusste das sogar schon zu Beginn seines Sturzes. Nichtstun, Warten und Frauen auf Partys: Darüber würde er einmal viel zu erzählen haben. Kurz zuvor fühlte er sich noch reich und bedeutend. "Und dann war plötzlich alles weg."
David Pfeifers Roman "Der Strand der Dinge" ist ein Reflex auf die Wirtschaftskrise, insbesondere ihrer Vorläufer 2001 im Goldrausch der New Economy, als man aufs Internet setzte und die Quellen rasant versiegten. 2007 hatte der 1970 geborene, in Berlin lebende Autor mit dem Buch "Klick. Wie moderne Medien uns klüger machen" noch ein Loblied auf digitale Vernetzung vorgelegt. Jetzt konzentriert er sich auf einen dieser kecken Jungunternehmer, der genau damit sein Geld verdiente und strandete. Gerade Verlierer-Romane aber steigen und fallen mit dem Wahrnehmungstalent ihrer Protagonisten.
Zunächst einmal hat man diesbezüglich Grund zur Hoffnung. Philip, der sich eben noch im schicken Büro spreizte und vollmundige Interviews gab, setzt nicht nur entwaffnend ehrlich zu einer kühlen Chronologie des Scheiterns an. Er registriert Feinheiten: das merkwürdige Gefühl der Erleichterung beim Scheitern; die grausame Logik der Ereignisse, die seine Branche zum Einsturz brachte; seine eigene manipulative Masche, die im Beruf noch zu Aufträgen verhalf, jetzt aber höchstens privat zündet. "Auf einmal saß ich in der Wartehalle des Lebens herum, wie viele meiner Altersgenossen." Schlaffheit macht ihm zu schaffen. Keine Idee will sich einstellen, obwohl er doch jetzt Zeit hätte. Schlimmer noch ist das Problem der Selbstdefinition nach dem peinigenden Verlust der "Insignien der Macht". "Nichts" tue er, bekennt Philip auf Parties, für die er offenbar lange noch Restgeld hat.
Lob des Müßiggangs; die Läuterung des kreativen Ex-Schnösels zum "glücklichen Arbeitslosen"; oder zum digitalen Boheme, wie ihn etwa die Autoren Sascha Lobo und Holm Friebe im Sinn haben - all dies hätte man erwartet. Doch der Stachel sitzt tief. Philip, aus der Designerwohnung geklagt und nunmehr ohne Kreditkarte, kappt alle Kontakte und zieht in eine WG mit Szenebekanntschaft Nils. Rauhfasertapete statt Edelputz und viele durchzechte Partynächte. Nach der narzisstischen Großkränkung bedürftig, lässt Philip keine Frau aus. Lange Strecken des Romans begleiten wir ihn nun auf Toiletten, wo er Koks aus der Vagina schnupft, auf Tanzflächen, wo er fesche Nellis wegträgt, die sich just dort erbrochen haben, während Philip selbst gerade fremdbaggerte. Austauschware, überall. Das geschilderte Hopping zwischen "ostentativ gelangweilter Barfrau" oder dick gewordener ehemaliger Schulkameradin, ob mit Sex oder ohne, wirft sprachlich nicht viel ab. Weil aber weiterhin begleitet vom distanzierten Selbstblick der Figur, kommt es doch zu komischen Momenten. Etwa, wenn Philip merkt, dass er schlechter abschneidet als seine weibliche Begleitung, zum Beispiel beim Essen kompliziert gefüllter Tortillas: "Ich hatte vergessen, dass Verena solche Speisen zu sich nehmen kann, ohne auch nur kleinste Rückstände im Mundwinkel kleben zu haben. Mir rann schon nach dem dritten Bissen ein dünnes Soßenbächlein in den Jackettärmel."
So blutleer und belanglos sich das insgesamt liest, so folgerichtig geht es aus der Figur hervor. Pfeifers Stärke liegt in der Milieubeschreibung, die Kraftlosigkeit dieser Prosa womöglich in ihrem Objekt, dem sich selbst endlos wiederkäuenden Milieu. Dessen Grundgesetz registriert Philip mit Schmerz: "Ohne Position wurde ich übersehen." Seine Einsichten befreien ihn aber kaum von Sozialisation und Gehabe. Des Vaters Mercedes begeisterte Philip schon mit sechs; geerbt gibt ihm das Statussymbol jetzt letzten Halt. Mehr und mehr wird dieser Bericht zum Autogramm einer gebrochenen Potenz und zeigt nebenbei auf eine Gesellschaft, die sich für Manipulierer wie Philip geradezu anbietet. Die New Economy, so vermittelt der Roman, wächst aus der Szene, in die Philip fällt.
Anders als Georg M. Oswald in seinem 2000 erschienenen Roman "Alles was zählt", der einen gefallenen Banker im Kleinkriminellenmilieu aufblühen lässt und strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Geld- und Diebeswelt herausstreicht, hat David Pfeifer aber nicht nur die Analyse der "Luxusarbeitslosen"-Scham im Sinn. Philip, der beim Flirten zwischen Coctails Musil zitiert, soll auch geläutert werden. Und so muss man noch einige Ausweichmanöver mitmachen, bis er sich, statt kontaktlose Allseitsbeziehungen zu pflegen, an aussichtsreichere Brüste wirft (die Yogalehrerin). Nur selten verdichten sich dabei seine Erfahrungen zu Aphorismen wie diesem: "Nichts tun war in Wahrheit auch nie nichts tun, es war nur dabei zusehen, wie die Dinge geschahen."
"Der Strand der Dinge" zeichnet - wie etwa auch Kristof Magnussons Roman "Das war ich nicht" - Krisendynamik nach. Zugleich aber generiert der Druck des Ich-Erzählers, dem Auflösungsprozess mit penetrantem Erzählen zu begegnen, Langatmigkeit und Houellebequesche Langeweile. Nebengeschichten hätten, wo sie nur doppeln, gekappt werden können; ebenso angestrengte Vergleiche: "Mein Problem war, dass ich mich für Sport nicht interessierte. Schwimmen, laufen oder Rad fahren fand ich so unterhaltsam wie ein Wachkoma." Oder: "Das Gesagte hing mir nach wie der Duft eines Menschen in einem Kleidungsstück." Mit Spracharbeitern wie Ulrich Peltzer oder Terézia Mora, deren gesellschaftsscharfer Blick zugleich eine überzeugende Poetologie hervorbringt, ist David Pfeifer nicht zu vergleichen.
ANJA HIRSCH
David Pfeifer: "Der Strand der Dinge". Roman. DuMont Verlag, Köln 2010. 286 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Pfeifers Stärke liegt in der Milieubeschreibung." -- FAZ
"Lebensnah und pointiert." -- GLAMOUR
"Klug, präzise und gemein." -- BILD AM SONNTAG
"Ein wirklich gutes Buch" -- 1LIVE
"Amüsanter Selbstfindungstrip" -- PRINZ
"Lebensnah und pointiert." -- GLAMOUR
"Klug, präzise und gemein." -- BILD AM SONNTAG
"Ein wirklich gutes Buch" -- 1LIVE
"Amüsanter Selbstfindungstrip" -- PRINZ
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Anja Hirsch stellt David Pfeiffer als den Autor vor, der noch 2007 in seinem Buch "Klick" ein Hohelied auf die digitale Vernetzung gesungen hat. Dass er sich in seinem Roman "Der Strand der Dinge" ihrer gescheiterten Herolde annimmt, registriert Hirsch mit verhaltener Genugtuung. Aber auch wenn sie anfangs noch glaubte, in Pfeiffer einen aufmerksamen Beobachter zu entdecken, stellt sich bald Enttäuschung bei der Rezensentin ein. "Blutleer und belanglos" findet sie die Geschichte vom pleite gegangenen Unternehmer, der sich nach der großen Kränkung arbeits- und lustlos durch Leben hangelt, aber offenbar immer noch genug Geld hat, sich durch das Berliner Nachtleben zu koksen und vögeln. Hirsch ist ziemlich schnell ermüdet und kreidet die "Kraftlosigkeit" von Pfeiffers Prosa dem beschriebenen, sich "endlos wiederkäuenden Milieu" der New Economy an.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH