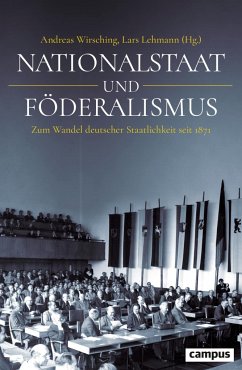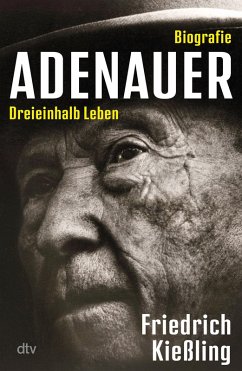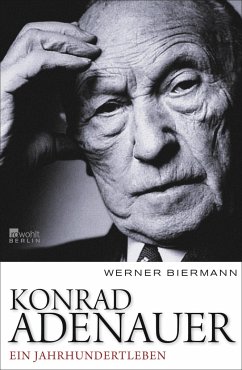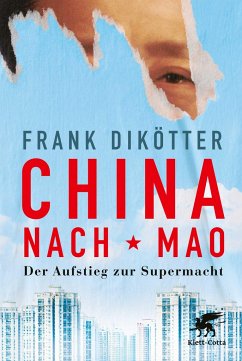Der Streitfall
Wie die Demokratie nach Deutschland kam und wie wir sie neu beleben müssen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Deutschland steckt in einer Polykrise, auch die DemokratieDie Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland nehmen zu. Der Blick zurück auf die Gründung der Bundesrepublik und die Krisen der vergangenen 75 Jahre zeigt: Unsere Demokratie ist stabiler, als viele Schwarzseher wahrhaben möchten. Der gesellschaftliche Zusammenhalt während der stürmischen Krisen der zurückliegenden Jahre - Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukrainekrieg - hat sich als resilient erwiesen. Und im europäischen Vergleich auffällig: Die radikalen Parteien können in Deutschland noch von ...
Deutschland steckt in einer Polykrise, auch die Demokratie
Die Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland nehmen zu. Der Blick zurück auf die Gründung der Bundesrepublik und die Krisen der vergangenen 75 Jahre zeigt: Unsere Demokratie ist stabiler, als viele Schwarzseher wahrhaben möchten. Der gesellschaftliche Zusammenhalt während der stürmischen Krisen der zurückliegenden Jahre - Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukrainekrieg - hat sich als resilient erwiesen. Und im europäischen Vergleich auffällig: Die radikalen Parteien können in Deutschland noch von der Macht ferngehalten werden. Aber die Anfechtungen sind groß und nur durch entschiedenes politisches Handeln, durch eine Reform des Rechtsstaats, kann Deutschland bleiben, was es ist: Eine freiheitliche Demokratie.
Die Herausforderungen für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland nehmen zu. Der Blick zurück auf die Gründung der Bundesrepublik und die Krisen der vergangenen 75 Jahre zeigt: Unsere Demokratie ist stabiler, als viele Schwarzseher wahrhaben möchten. Der gesellschaftliche Zusammenhalt während der stürmischen Krisen der zurückliegenden Jahre - Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, Ukrainekrieg - hat sich als resilient erwiesen. Und im europäischen Vergleich auffällig: Die radikalen Parteien können in Deutschland noch von der Macht ferngehalten werden. Aber die Anfechtungen sind groß und nur durch entschiedenes politisches Handeln, durch eine Reform des Rechtsstaats, kann Deutschland bleiben, was es ist: Eine freiheitliche Demokratie.