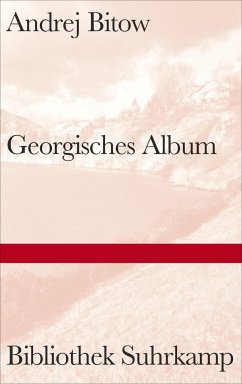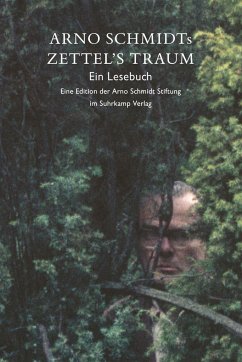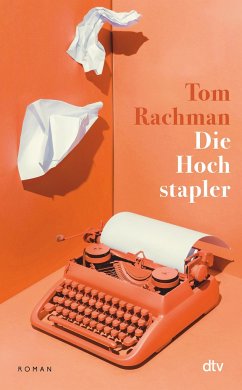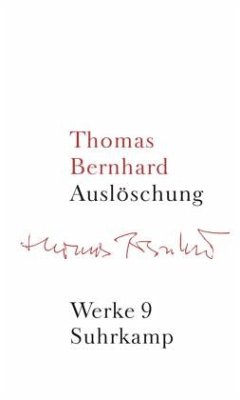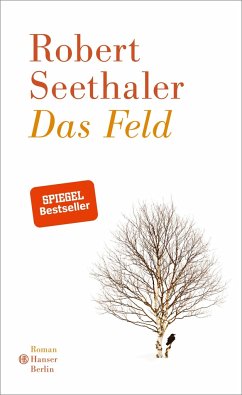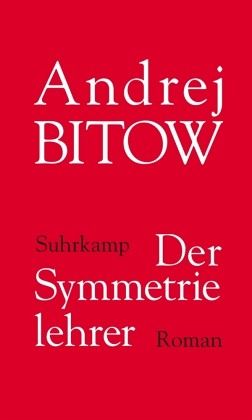
Der Symmetrielehrer
Roman
Übersetzung: Tietze, Rosemarie

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine Gruppe Geologen sitzt bei schlechtem Wetter in der Taiga fest. Um die Zeit zu vertreiben, erzählt der Übersetzer A. B. ein »ausländisches« Buch nach, das er nur halb verstanden hat und deshalb mit Erfindungen ausschmückt. Zehn Jahre später - das Buch ist verschollen, sein Inhalt lange vergessen - steht A. B. plötzlich ein Kapitel vor Augen, vollständig, wie eine Vision. Während sein Gedächtnis den Text speichert, wird das Ereignis, das die Vision ausgelöst hat, gelöscht. Aus dieser irritierenden Erfahrung erwächst Andrej Bitows Meisterwerk, in dem er sich den letzten Dingen ...
Eine Gruppe Geologen sitzt bei schlechtem Wetter in der Taiga fest. Um die Zeit zu vertreiben, erzählt der Übersetzer A. B. ein »ausländisches« Buch nach, das er nur halb verstanden hat und deshalb mit Erfindungen ausschmückt. Zehn Jahre später - das Buch ist verschollen, sein Inhalt lange vergessen - steht A. B. plötzlich ein Kapitel vor Augen, vollständig, wie eine Vision. Während sein Gedächtnis den Text speichert, wird das Ereignis, das die Vision ausgelöst hat, gelöscht. Aus dieser irritierenden Erfahrung erwächst Andrej Bitows Meisterwerk, in dem er sich den letzten Dingen des literarischen Daseins zuwendet: dem Verhältnis zwischen Autor und seinen Geschöpfen; der Schriftstellerexistenz, die Schuld und Schmerz zurücklässt; der Liebe, die dem Schreiben geopfert wird; und nicht zuletzt Russland »als Versuch Gottes, die Zeit durch den Raum zu ersetzen«.Ein ungemein intelligent komponiertes, ironisch gefärbtes, doch unverhohlen melancholisches Buch. Opus magnum und Lebensbilanz: das Schlüsselwerk eines Autors von Weltrang.