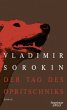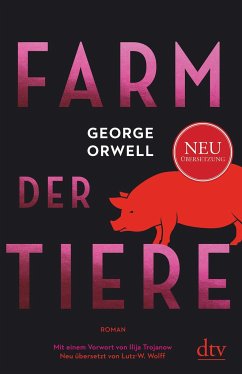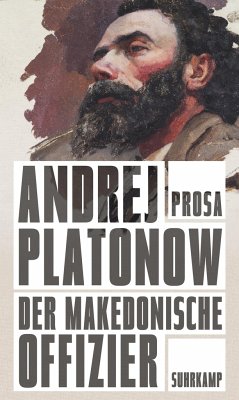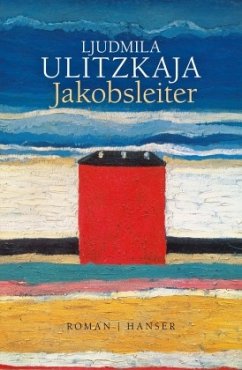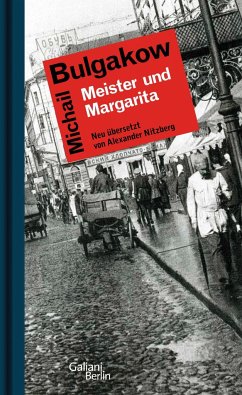Nicht lieferbar

Der Tag des Opritschniks
Roman
Übersetzung: Tretner, Andreas
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
»Russlands Gegenwart ist nur noch mit den Mitteln der Satire zu beschreiben.« Vladimir Sorokin Russland im Jahr 2027. Das Land hat sich vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport, pflegt Handelskontakte nur noch mit China und wird vom »Gossudar«, einem absoluten Alleinherrscher regiert. Dieser übt seine Macht mithilfe der Opritschniki, der »Auserwählten«, aus: einer allmächtigen Leibgarde, die vor keiner Bestialität zurückschreckt.Die Zeit der großen Wirren ist vorbei, die Restauration beendet. Nun hat die Monarchie wieder die Macht ergriffen. Das Land ist von der ...
»Russlands Gegenwart ist nur noch mit den Mitteln der Satire zu beschreiben.« Vladimir Sorokin Russland im Jahr 2027. Das Land hat sich vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport, pflegt Handelskontakte nur noch mit China und wird vom »Gossudar«, einem absoluten Alleinherrscher regiert. Dieser übt seine Macht mithilfe der Opritschniki, der »Auserwählten«, aus: einer allmächtigen Leibgarde, die vor keiner Bestialität zurückschreckt.
Die Zeit der großen Wirren ist vorbei, die Restauration beendet. Nun hat die Monarchie wieder die Macht ergriffen. Das Land ist von der Großen Russischen Mauer umgeben und - bei allem technologischen Fortschritt - in die dunkle Zeit Iwans des Schrecklichen zurückgefallen.
Die Opritschniki, die »Diener des Gossudar«, sind in roten Limousinen unterwegs, mit Hundeköpfen an den Stoßstangen und Besen am Kofferraum - Symbole dafür, dass jeglicher Widerstand ausgemerzt und von der russischen Erde gefegt wird. Zu dieser brutalen und korrupten Elite gehört auch Andrej. Seinen Arbeitstag beginnt er mit der Hinrichtung eines in Ungnade gefallenen Oligarchen, dann wohnt er der Auspeitschung von Intellektuellen bei, ist der liebestollen Gemahlin des Gossudar zu Diensten und beschließt den Tag mit einer dekadenten Orgie.
Der Tag des Opritschniks ist eine schmerzhafte Satire, eine negative Utopie im Sinne von Huxley, Orwell und Burgess. Das Erschreckende daran ist, dass sie der russischen Gegenwart beunruhigend nahekommt.
Der Tag des Opritschniks erscheint im Januar 2008 gleichzeitig in elf Sprachen.
»Das epochale Werk blickt ins Innere jenes schwarzen Knotens, der die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, und es tut dies ebenso märchenhaft zeitlos wie hochaktuell.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die Zeit der großen Wirren ist vorbei, die Restauration beendet. Nun hat die Monarchie wieder die Macht ergriffen. Das Land ist von der Großen Russischen Mauer umgeben und - bei allem technologischen Fortschritt - in die dunkle Zeit Iwans des Schrecklichen zurückgefallen.
Die Opritschniki, die »Diener des Gossudar«, sind in roten Limousinen unterwegs, mit Hundeköpfen an den Stoßstangen und Besen am Kofferraum - Symbole dafür, dass jeglicher Widerstand ausgemerzt und von der russischen Erde gefegt wird. Zu dieser brutalen und korrupten Elite gehört auch Andrej. Seinen Arbeitstag beginnt er mit der Hinrichtung eines in Ungnade gefallenen Oligarchen, dann wohnt er der Auspeitschung von Intellektuellen bei, ist der liebestollen Gemahlin des Gossudar zu Diensten und beschließt den Tag mit einer dekadenten Orgie.
Der Tag des Opritschniks ist eine schmerzhafte Satire, eine negative Utopie im Sinne von Huxley, Orwell und Burgess. Das Erschreckende daran ist, dass sie der russischen Gegenwart beunruhigend nahekommt.
Der Tag des Opritschniks erscheint im Januar 2008 gleichzeitig in elf Sprachen.
»Das epochale Werk blickt ins Innere jenes schwarzen Knotens, der die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, und es tut dies ebenso märchenhaft zeitlos wie hochaktuell.« Frankfurter Allgemeine Zeitung