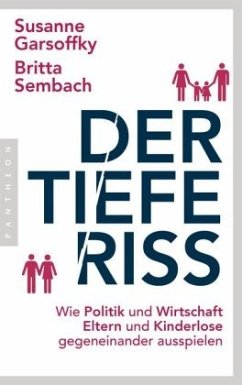Eines der letzten gesellschaftlichen Tabus
Unser Sozialsystem benachteiligt Eltern, weil wir zwar Kinder brauchen, um es zu finanzieren, Kinder groß zu ziehen aber kaum honoriert wird. Arbeitgeber bevorzugen Kinderlose, dadurch ist Kinderlosigkeit gerade für gut ausgebildete Männer und Frauen ein attraktives Lebensmodell geworden. Kinderlose wiederum zahlen in den meisten Unternehmen mit Überstunden für die fehlgeschlagene Vereinbarkeitspolitik der vergangenen Jahre.
So entsteht ein tiefer gesellschaftlicher Riss. Um ihn zu überbrücken, brauchen wir ein gerechtes, völlig umgestaltetes Sozialsystem - weg vom Generationenvertrag - und ein Umdenken in den Unternehmen.
Unser Sozialsystem benachteiligt Eltern, weil wir zwar Kinder brauchen, um es zu finanzieren, Kinder groß zu ziehen aber kaum honoriert wird. Arbeitgeber bevorzugen Kinderlose, dadurch ist Kinderlosigkeit gerade für gut ausgebildete Männer und Frauen ein attraktives Lebensmodell geworden. Kinderlose wiederum zahlen in den meisten Unternehmen mit Überstunden für die fehlgeschlagene Vereinbarkeitspolitik der vergangenen Jahre.
So entsteht ein tiefer gesellschaftlicher Riss. Um ihn zu überbrücken, brauchen wir ein gerechtes, völlig umgestaltetes Sozialsystem - weg vom Generationenvertrag - und ein Umdenken in den Unternehmen.

Alarmstufe Nachwuchs: Susanne Garsoffky und Britta Sembach wollen den Riss zwischen Eltern und Kinderlosen heilen. Aber ihr Plädoyer für eine neue Familienpolitik trägt nicht sehr weit.
Zwei Frauen, vier Kinder, ein Thema: der Untergang der Familie. Die Autorinnen, beide Jahrgang 1968, sind freie Journalistinnen. Und sie sind wütend. Denn sie sind Mütter, jede von ihnen hat zwei Söhne. Die beiden Frauen gehören zu den "abgekämpften Familienarbeiterinnen", die wissen, was es bedeutet, Kinder großzuziehen. Und jetzt schreiben sie, anstatt zu schreien. Sie glauben nämlich, dass es einen Grund gäbe, laut zu schreien. Die Kinder, die für das verantwortungslose Verhalten der Erwachsenen gar nichts können, "werden am Ende den Preis für alle heutigen Versäumnisse bezahlen".
Zutiefst beunruhigt zeigen sie sich von dem "tiefen Riss", der sich durch unsere Gesellschaft ziehe - ein Riss zwischen Eltern und Kinderlosen. Höchste Zeit also, Brücken zu bauen, finden Susanne Garsoffky und Britta Sembach, für einen Paradigmenwechsel "zu einer vom Kind her gedachten Familienpolitik". Sie sind überzeugt, dass dies auch Kinderlosen gerecht wird, schließlich gibt es ohne Kinder keine Zukunft.
Von zwei getrennten Welten erzählen die beiden Mütter und beobachten - ganz unparteiisch - die Kinderlosen, die zum Beispiel "in einem kleinen kuscheligen Café zum Brunch mit Freunden" sitzen, "Sonntags, so gegen zwei". Mit dem Alltag der engagierten Mütter hat ein solches Leben wenig zu tun. Sie brunchen nicht, ist aus dieser Episode zu lernen, sondern haben einen höchst strapaziösen Alltag, etwa "im herbstlichen Sprühregen samstagmorgens um acht auf dem Fußballplatz zu stehen".
Keine der beiden Welten sei schlechter oder besser als die andere, beteuern die Autorinnen zwar, aber belegt ihre Gegenüberstellung das tatsächlich? Da gibt es auf der einen Seite "diejenigen, die Sorgeverpflichtungen haben, mit allen möglichen persönlichen Belohnungen, die daraus entstehen, aber eben auch allen ökonomischen Belastungen". Das sind die Eltern. Auf der anderen Seite stehen "diejenigen, die diese Verpflichtungen nicht haben - mit allen ökonomischen Belohnungen, die sich daraus ergeben, aber auch allen möglichen persönlichen Belastungen". Das sind die Kinderlosen.
Einer solchen Machart folgt das gesamte Buch. Die Autorinnen pauschalisieren, vereinfachen und folgen einem ideologisierten Schwarz-Weiß-Denken, das sämtliche Facetten jenseits ihrer Demarkationslinie außer Acht lässt und überhaupt erst den Riss produziert, den sie zu kitten vorgeben. Richtig: Kinder kosten Geld, für das die Eltern aufkommen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Kinderlosen automatisch wohlhabender sind. Was ist mit den Geringverdienern unter ihnen? Was ist mit jenen, die kinderlos Teilzeit arbeiten müssen (ein Modell, das nach Auffassung der Autorinnen alleiniges Schicksal von schuftenden Müttern ist), zum Beispiel weil sie keine andere Stelle bekommen? Was ist mit den Müttern, die ungewollt Kinder bekommen haben? Und woher nehmen die Autorinnen die Gewissheit, dass Kinderlosigkeit für die Betroffenen eine Belastung darstellt?
Darauf finden sie eine Antwort in der Biologie. Sie kritisieren, dass "wir den Mann als Norm betrachten, wenn wir über Frauen und Beruf sprechen". Die männliche Norm stehe für Wettbewerb und Konkurrenz, Härte und Durchsetzungsfähigkeit. Frauen hätten andere Präferenzen: "Ist es möglicherweise eine biologische Tatsache, dass Frauen sich gern kümmern?" Daraus abzuleiten, dass sie sich auch kümmern müssen, sei zwar falsch, aber Frauen seien eben andere Dinge wichtig: "Sie entscheiden sich, wenn es drauf ankommt und sie die Möglichkeit dazu haben, oft eher für die Liebe statt für (mehr) Geld."
Kinderlosigkeit stellt demnach eine Abweichung von der weiblichen Natur dar. Folgerichtig konzentrieren Garsoffky und Sembach sich auf die "ungewollt Kinderlosen"; dass Frauen freiwillig auf Kinder verzichten und damit glücklich sind, halten sie aber nicht für sehr wahrscheinlich. Damit nicht genug, suggerieren die Autorinnen, dass Frauen ohne Kinder grundsätzlich weniger Bereitschaft zeigten, sich um andere Menschen zu kümmern. Sie könnten und wollten zwar niemanden auffordern, Kinder zu bekommen, legen es aber implizit doch nahe.
Die Autorinnen begeben sich in ein Fahrwasser, das Vorurteile gegen Frauen im Allgemeinen, ihre Reduktion auf Emotionalität, "Liebe" und Fürsorglichkeit, und Vorurteile gegen kinderlose Frauen im Besondern bestätigt. Obwohl das eine aus dem anderen nicht unmittelbar zu schließen ist, gelten Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, nicht nur als "unweiblich", sondern oftmals auch als Kinderfeinde. Dass man selbstbestimmt kinderlos und trotzdem kinderlieb sein kann, liegt im selbstreferentiellen System der Elternschaft außerhalb des Denkbaren.
Ungewollt bestätigen Garsoffky und Sembach auch Vorurteile gegenüber Eltern von heute: über ihre unverhältnismäßige Anspruchshaltung, über ihren Drang, sich durch ihre Kinder selbst zu verwirklichen und sie als Statussymbol zu betrachten, über ihren Unwillen, ihr Elternsein einfach zu praktizieren, anstatt es aufwendig zu inszenieren. Dass es auch ganz andere Eltern gibt, gerät dabei schnell aus dem Blick.
Der reißerische Tonfall macht die Sache keineswegs besser. Da ist von einer "Mutterschaftsbestrafung" die Rede, da wird behauptet, es sei hierzulande völlig in Ordnung, "engagierte Mütter hemmungslos fertigzumachen und öffentlich vorzuführen", da klagen die Autorinnen, man könne schon froh sein, "auf dem Spielplatz nicht mit faulen Eiern und Tomaten beworfen zu werden", wenn man sich selbst um seine Kinder kümmert. Diese Emphase, die jegliche Sachebene verlässt, korrespondiert mit dem "Wir", das die Autorinnen sich durchgehend zu eigen machen. Dabei bleibt unklar, in wessen Namen sie hier sprechen wollen. Mal scheinen sie bloß sich selbst zu meinen, mal die ganze Gesellschaft, mal nur die Frauen.
Das ist nicht nur methodisch unsauber, sondern suggeriert auch ein kollektives Einverständnis, das es in diesen Fragen nicht gibt. Das zentrale Problem, das Garsoffky und Sembach antreibt, ist aber pekuniärer Natur. Es geht schlicht und einfach ums Geld. Sie fühlen sich als Mütter benachteiligt und machen daraus ein Politikum. Weil Kinderlose nicht für die enormen Kosten aufkommen müssten, die Kinder verursachten, und somit das Sozialsystem in unserer alternden Gesellschaft, dem "Demografie-Dilemma", belasteten, ohne in Form von eigenen Kindern in die Zukunft zu investieren, plädieren die Autorinnen für einen Aufschlag auf die Einkommensteuer für Kinderlose. Auch das bedingungslose Grundeinkommen halten sie für eine gute Idee - könnte es doch dazu beitragen, dass die angeblich so männliche Norm in unserer Arbeitswelt überwunden und Frauen sich den Dingen widmen können, die für sie wichtig sind.
Dennoch ist das Buch als Wohlstandsindikator unserer Gesellschaft aufschlussreich. Richtig ist: Elternsein hat sich verändert, auf habitueller Ebene nicht unbedingt zu seinem Vorteil (wovon dieses Buch unfreiwillig beredtes Zeugnis ablegt). Und es gibt Konflikte zwischen Eltern und Kinderlosen, von denen Frauen viel mehr betroffen sind als Männer. Das alles zeigt sich in einem Gewand, das aus soziologischer Perspektive gar nicht so uninteressant ist. Auch aus feministischer Sicht kann das wichtig sein, denn noch immer stehen kinderlose Frauen unter einem enormen gesellschaftlichen Rechtfertigungsdruck. Und der demographische Wandel ist eine Herausforderung, die ernsthaft kaum jemand kleinreden würde.
Müttern und Eltern geht es heute so gut wie noch nie. Wir haben ein engmaschiges Sozialsystem, von dem andere Länder nur träumen können. Wer auf so hohem Niveau voller Inbrunst klagt, macht den Anlass der Klage nicht transparent, sondern demonstriert vor allem, wie verwöhnt diese Gesellschaft ist.
HANNAH BETHKE
Susanne Garsoffky und Britta Sembach: "Der tiefe Riss". Wie Politik und Wirtschaft Eltern und Kinderlose gegeneinander ausspielen.
Pantheon Verlag, München 2017. 256 S., br., 15,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ein emotionales Sachbuch - beachtenswert" Ferdinand Knauß , WirtschaftsWoche