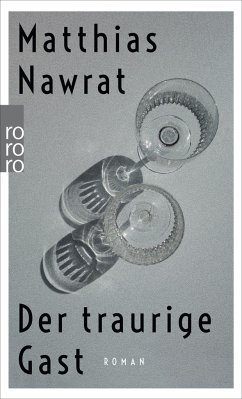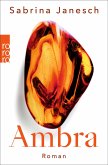Matthias Nawrats vierter Roman, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, handelt vom Überleben, in aller Schönheit, trotz allem Schrecken.
Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Ein Mann ohne Namen begegnet den Menschen in seiner Umgebung mit neuer Aufmerksamkeit: Dariusz, dem Tankwart, der einmal Chirurg war und einen Sohn hatte, der in Südamerika verschwand. Eli, dem polternden Überlebenskünstler. Oder Dorota, der alten polnischen Architektin, deren intellektuelle Energie auf ihn genauso verwirrend wie ansteckend wirkt. Sie erzählen ihm aus ihrem Leben, aber nicht nur: Ihre Geschichte ist unsere gewesen, und sie wird unsere sein.
«Der traurige Gast» ist eine Selbst- und Weltbefragung von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neu-Ankommen bedeuten.
Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Ein Mann ohne Namen begegnet den Menschen in seiner Umgebung mit neuer Aufmerksamkeit: Dariusz, dem Tankwart, der einmal Chirurg war und einen Sohn hatte, der in Südamerika verschwand. Eli, dem polternden Überlebenskünstler. Oder Dorota, der alten polnischen Architektin, deren intellektuelle Energie auf ihn genauso verwirrend wie ansteckend wirkt. Sie erzählen ihm aus ihrem Leben, aber nicht nur: Ihre Geschichte ist unsere gewesen, und sie wird unsere sein.
«Der traurige Gast» ist eine Selbst- und Weltbefragung von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neu-Ankommen bedeuten.
Ein Roman von großer literarischer Kraft und philosophischer Tiefe ... zutiefst beeindruckend. Marta Kijowska FAZ.NET 20190320

Ein namenloser Erzähler streift im Winter des Terroranschlags durch Berlin:
Matthias Nawrats neuer Roman „Der traurige Gast“ zieht die Leser leise in seinen Bann
VON JULIANE LIEBERT
Ein Mann fährt auf „die andere Seite der Stadt“, Berlins, zum Südstern. Gerade endet die Messe der polnischen Gemeinde in einer neben der vatikanischen Nuntiatur gelegenen Kirche. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein kleines polnisches Restaurant und Feinkostgeschäft. Dort geht der Mann essen und unterhält sich kurz mit einem ehemaligen Klavierstimmer, der sich zu ihm an den Tisch setzt, während immer mehr Besucher des Gottesdienstes in den Laden strömen. Wer jemals an einem Sonntag in der Gegend spazieren war, wird bestätigen können, dass alle Details wirklichkeitsgetreu geschildert sind. Selbst der Name des Restaurants, „Mały Książę“, „Der kleine Prinz“, ist korrekt. Damit ist der Ton gesetzt. Der Text bewegt sich ganz dicht an nachprüfbaren Fakten. Wir erfahren, dass der Erzähler, wie sein Autor, offenbar polnischstämmig und Schriftsteller ist.
Es geschieht wenig. Die Pierogi sind nicht die besten, die er jemals gegessen hat, aber gut. Das Gespräch ist vordergründig belanglos. Und trotzdem baut sich eine eigenartige Spannung auf. Es ist, als wäre die ganze Szene mit einem Summen unterlegt, dem Betriebsgeräusch hochgeregelter Wahrnehmungsempfindlichkeit.
Matthias Nawrat hat mit seinen bisher drei Romanen ein hohes Formbewusstsein bewiesen. Als Zehnjähriger kam er 1989 mit seinen Eltern nach Deutschland. Nach dem Abitur studierte er zunächst Biologie, und man ist versucht, eine Analogie zwischen der Wandelbarkeit seines literarischen Stils und der Lehre von den Lebewesen zu ziehen. Um morphologische Merkmale oder die Feinheiten der Zellfunktion entschlüsseln zu können, sind eine scharfe Mustererkennung und klare Kategorien nötig. Aber um sie wirklich zu verstehen, auch ein zärtliches Staunen. Denn wir betrachten unsere eigenen Wurzeln, die Bausteine unserer Existenz und die Vielfalt, deren Teil wir sind.
Literatur will dieses Staunen über die Phänomene immer wieder neu ermöglichen. Dafür muss sie die richtige Form finden. Im vielgelobten Buch „Die vielen Tode unseres Opas Jurek“ (2015) war das der Schelmenroman, der einmal quer durch die polnisch-europäische Geschichte führte und vor Auschwitz nicht haltmachte. Auf welche Weise von der Vernichtung der Juden in fiktionalen Texten die Rede sein kann, wird aktuell wieder diskutiert. Auch die launigen Berichte des Opas Jurek sorgten seinerzeit bei manchen Rezensenten für Irritationen. Aber Nawrat hatte seine Entscheidung, das Unvorstellbare durch die Augen des Picaros zu zeigen, nicht leichtfertig getroffen.
Sein jüngster Roman ist der Krise abgelauscht. Einer Krise des Schreibens, begriffen wenn nicht als Symptom, dann doch als in Verbindung stehend mit einer fundamentalen Leerstelle im Leben der Menschen. „Der traurige Gast“ – das ist zunächst der Erzähler selbst. In den Monaten vor und nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, der so etwas wie den beiläufigen Angelpunkt des Romans bildet, streift er, offenbar unfähig, seinem Beruf nachzugehen, also zu schreiben, durch die Stadt, lernt Menschen aus verschiedenen, einander kaum berührenden Milieus kennen, besucht sie und hört ihnen zu. Nicht selten tut er das widerwillig, aber er kann sich nicht losreißen. Es ist, als sei es seine Bestimmung, sich ganz auf seine Nächsten einzulassen. Er erinnert darin an die Engel im Wim-Wenders-Film „Himmel über Berlin“. Allerdings mit dem Unterschied, dass seine Menschlichkeit außer Zweifel steht und ihm wohl bewusst ist.
Seine „Berufsunfähigkeit“ und irgendwann sogar der Unwille, überhaupt noch vor die Tür zu gehen, werden Voraussetzung, um so empfänglich gegenüber der Welt zu sein. Von Pathos keine Spur. Alle, denen er zuhört, sind versehrt, versuchen ihrer Vergangenheit eine Form zu geben, mit der sie heute leben können. Sei es die Architektin, die ihr Haus kaum noch und ihr Viertel in Schöneberg gar nicht mehr verlässt, oder der bei einer Tankstelle jobbende frühere Arzt, der säuft und den Tod seines Sohnes nicht verwinden kann. Sie philosophieren aus existenzieller Notwendigkeit. In ihren Geschichten, ihren Orientierungsversuchen wird alles gleichermaßen Gegenwart.
Oder vielleicht eher: Die Gegenwart weitet sich in die Vergangenheit hinein. Das Schicksal historischer Personen wie des polnisch-jüdischen Dichters Arnold Słucki, der seine Heimat verlor und schließlich in West-Berlin strandete, wo er mit 52 Jahren starb, findet ebenso seinen Platz wie verschrobene Privatphilosophien, Schuldgefühle, Migrationserfahrungen. Es ist ein Anerzählen gegen die Vergeblichkeit, in dem die Verwerfungen eines Jahrhunderts sichtbar werden. Der misstrauische Junge vom Hinterhof ist ebenso unbehaust wie die polnischen Auswanderer oder die Rumäniendeutschen. Die Sinne des Ichs, das von all dem berichtet, sind hellwach. Besonders reizoffen ist es gegenüber der Stadt. Sein Zustand zwischen Erschöpfung und Unruhe lässt Alltägliches ganz leicht überbelichtet erscheinen.
Im Kontext der verschiedenen Lebensgeschichten und verstörenden Ereignisse, allen voran der Terroranschlag, wird ohne jede Kulissenschieberei der spezifische Charakter Berlins deutlich. Die Stadt ist Magnet und ewiger Transitraum. Zwischen den Zeiten, zwischen Ost und West. Zwischen den Kulturen. Alle landen irgendwie hier. Niemand scheint wirklich ganz angekommen zu sein. „Jede Straße sah plötzlich identisch aus“, so die Architektin über einen Spaziergang. „Ich war nur zweimal abgebogen. Ich kehrte um und ging den Weg zurück, den ich gekommen war. Aber mir kam kein einziges Gebäude mehr bekannt vor, ich hatte sie noch nie in meinem Leben gesehen. Ich wusste nicht mehr, welche Farbe die Eingangstür unseres Wohnhauses hatte.“
Als in den Nachrichten gemeldet wird, dass ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast ist, schaut der Erzähler gerade eine amerikanische Serie. Während die junge französische Autorin Frederika Amalia Finkelstein in ihrem Roman „Überleben“ (dt. 2018) auf die traumatisierende Wirkung der Pariser Anschläge fokussierte, verdichtet der – nur medial wahrgenommene – Einbruch der Gewalt bei Nawrat eine grundsätzliche Verlorenheit: „Ich hatte plötzlich das Gefühl, irgendwo zwischen Manhattan und meinem Zimmer zu sein, in einem leeren Zwischenbereich“. Seine kunstvolle, aber unprätentiöse Erzählweise ist das Gegenteil des ominösen Kopfkinos, das manche Reportagejournalisten für erstrebenswert halten. Sie simuliert kein Miterleben, keine bewegten HD-Bilder. Sie stellt Präsenz her. Das Ich dieses Romans registriert seine Empfindungen punktgenau, befragt sie mitunter knapp. Irritationen werden benannt, nicht aufgelöst.
„Der traurige Gast“ entstand aus entschlackten, stilistisch geschliffenen Tagebucheinträgen, die dann mit den Berichten der Romanfiguren angereichert wurden. In diesen Passagen finden sich kleinere Schwächen. An manchen Stellen scheint die Recherchefleißarbeit zu sehr durch, dann wird es langatmig. Dass die Paranoia, die den Erzähler nach dem islamistischen Terroranschlag erfasst, unmittelbar mit der Lektüre über die Gräueltaten von Kolonialisten kontrastiert werden muss, wirkt etwas pflichtschuldig. Auch die gleichförmige „Sagte-sie-sagte-ich“-Lakonie kann einen phasenweise ungeduldig machen. Das fällt aber kaum ins Gewicht, weil die narrative Grundkonzeption und ihre sorgfältige Ausführung in den Bann ziehen.
Man vollzieht die Wahrnehmungs- und Reflexionsbewegung eines wirklichen Subjekts nicht nur nach, sondern mit. Das funktioniert durch Wiedererkennen: „Ich zahlte vorne an der Kasse, bei derjenigen der zwei jungen Frauen, von der ich glaubte, dass sie Małgorzata hieß, und trat in die kühle Winterluft hinaus, für einen Moment geblendet von dem grellen Himmel, der sich über die Kirche und den Friedhof auf der anderen Straßenseite und über die ganze Stadt spannte. Ich brauchte einen Moment, bis ich wieder wusste, wo ich war, und ging dann los, Richtung U-Bahn-Station.“ Es ist dieser Augenblick der Orientierungslosigkeit, des Übergangs, wenn das Bewusstsein im Alltag flackert, der packt. Jeder kennt das, nimmt es ohne größere Irritation hin. Hier wird es, im „Diaspora“ betitelten ersten Kapitel, zum Erkenntnisprinzip des Romans. Er ist ein Beispiel integeren Erzählens.
Matthias Nawrat: Der traurige Gast. Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek 2019. 304 Seiten, 22 Euro.
In diesen Geschichten wird
alles, auch die Vergangenheit,
gleichermaßen Gegenwart
„Ich hatte plötzlich das Gefühl,
irgendwo zwischen Manhattan
und meinem Zimmer zu sein …“
Berlin am 20. Dezember 2016, einen Tag nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz: Totengedenken vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
Foto: Regina Schmeken
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensentin Ursula März trifft auf eine ideale Balance zwischen Fiktion und historischer Wahrheit in Matthias Nawrats Berlin-Flaneur-Roman. Dem Erzähler im Jahr 2016 auf seinen Spaziergängen durch Berlin folgend, fühlt sich März an die literarische Erinnerungskunst von Patrick Modiano erinnert. Wenn Nawrats Erzähler der Spur polnischer Migranten bis tief in die Vergangenheit folgt, stört sich März zwar an dem ein oder anderen verzichtbaren politischen Diskurs, freut sich aber umso mehr über von Empfindsamkeit geprägte Wahrnehmungssplitter und die Fähigkeit des Autors, manchem Berlin-Klischee seinen "unverbrauchten Blick" entgegenzusetzen. Gleichfalls geglückt findet sie die Figuren-Porträts und die mit ethnografischer Sorgfalt ausgeführten Darstellungen von migrantischer Entwurzelung, in der sich laut März Vergangenheit und Gegenwart treffen und sich eine "literarische Moral" zeigt, die Geschichte nicht nur als Lieferanten für interessante Plots ausbeutet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie ist es, wenn man nur in den Geschichten anderer Leute lebt? Matthias Nawrats eindrucksvoller Episodenroman "Der traurige Gast" führt es vor.
Der Anfang klingt ziemlich unspektakulär: Der Ich-Erzähler, ein junger Berliner Pole, fährt an einem Wintersonntag ans andere Ende der Stadt. In einem Restaurant, das sich in der Nähe einer polnischen Kirche befindet, möchte er eine Portion Pierogi, also leicht klebrige Maultaschen, die zum eisernen Repertoire jedes polnischen Lokals gehören, und die Nähe seiner Landsleute genießen. Seine Eskapade scheint sich wenig gelohnt zu haben. Das Restaurant hat außer dem Namen, "Der kleine Prinz", nichts Sympathisches an sich, das Essen schmeckt durchschnittlich, das Gespräch, das er mit seinem Tischnachbarn, einem ehemaligen Klavierstimmer, führt, ist ebenso banal wie der Inhalt seines Tellers. Und da in der Kirche die Messe zu Ende gegangen ist und das Restaurant sich langsam füllt, zahlt er und tritt wieder in die kühle Berliner Winterluft hinaus, "für einen Moment geblendet von dem grellen Himmel, der sich über die Kirche und den Friedhof auf der anderen Straßenseite und über die ganze Stadt" spannt.
Trotz der Verheißung einer Erweiterung der Perspektive, die in diesem Nebensatz steckt, verlässt einen der Eindruck der Banalität, die womöglich erzählerisch in eine Sackgasse führen könnte, auch über die nächsten Seiten nicht. Denn der namenlose Erzähler, ein angehender Schriftsteller, der "über verschiedene Dinge, zuletzt über meine Familie und Leute, die ich kenne", schreibt, nimmt sich viel Zeit, um über seinen Alltag zu berichten. Über einen Spaziergang, bei dem er sich "von der Stimmung der Leute treiben" lässt, den Gang zum Friseur, die Umbaupläne, die er und seine Frau in Bezug auf ihre Wohnung schmieden. Allerdings wird dem Leser schnell klar, dass dies von Matthias Nawrat durchaus beabsichtigt ist, dass er von seinem sorgfältig komponierten, dreiteiligen Roman keine in sich geschlossene Geschichte erwarten, sondern sich eben auf viele kleine Episoden einstellen soll. Und er merkt auch recht bald, wie sehr ihn diese Geschichten zu faszinieren beginnen.
Dieses Gefühl kommt spätestens dann auf, als der Erzähler eine ältere polnische Architektin namens Dorota kennenlernt, die zwar immer noch Aufträge annimmt, sich aber dabei weigert, ihr Viertel zu verlassen. Er hat sie im Zusammenhang mit seinen Umbauplänen kontaktiert und ist seitdem häufiger Gast in ihrer Schöneberger Wohnung, in der sie ihm einen ungenießbaren Kuchen vorsetzt und aus ihrem Leben erzählt. Oder auch aus dem Leben eines anderen. Etwa dem des polnisch-jüdischen Dichters Arnold Slucki, der, einst glühender Kommunist, infolge der antisemitischen Hetze von 1968 seine Privilegien und seine Heimat verlor, nach Israel emigrierte und sich schließlich in West-Berlin niederließ, wo er mit 52 Jahren starb.
Dorotas Schilderungen haben für den Erzähler eine ebenso starke Anziehungskraft wie ihre Ansichten über Kunst und Architektur oder ihre exzentrische Art. Trotzdem hat er manchmal beim Verlassen ihrer Wohnung das Gefühl, "entkommen, gerettet worden zu sein", was sich auch bei seinem letzten Besuch gewissermaßen bestätigt: Er erfährt, dass die Architektin sich in ihrem Schlafzimmer erhängt hat.
Seine Unruhe und Verwirrung werden bald durch weitere Begegnungen gesteigert - etwa mit Karsten, seinem früheren Studienfreund, der bei der Charité als Molekularbiologe arbeitet und dabei von einer Sinnkrise geplagt wird. Und vor allem mit Dariusz, einem ebenfalls polnischen Ex-Chirurgen, der mal an einer Tankstelle, mal in billigen Kneipen jobbt und sich abends in seiner schäbigen Souterrainwohnung besäuft, um dadurch leichter mit dem Tod seines Sohnes, der nach Südamerika ausgewandert und dort ertrunken ist, fertig zu werden.
Die meisten der Geschichten, die der Erzähler zu hören bekommt, bieten wenig Trost oder Grund zur Hoffnung. Teils, weil sie im Schatten der historischen Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts stehen; aber auch die der Gegenwart sorgen immer öfter für Angst und Verunsicherung. Die winterliche Kulisse der Handlung führt es den Protagonisten besonders scharf vor Augen: Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, und der Schock, in den er die Stadt versetzt hat, wirkt in den Alltag jedes Einzelnen hinein.
Auch der seelische Frieden des Erzählers gerät also zunehmend aus den Fugen, und die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich ihm immer klarer. Er ist zwar in all den fremden Geschichten nur "der traurige Gast", dadurch aber, dass sie ihm sehr real erscheinen, bieten sie eine große Projektionsfläche für seine eigenen Erinnerungen, Assoziationen und Reflexionen. Das vermutet man zumindest aufgrund der Neugier, die er seinen Gesprächspartnern entgegenbringt, denn ein anregender Zuhörer ist er weiß Gott nicht. Er stellt kaum Fragen, mit polemischen Kommentaren hält er sich auch zurück, und als er sich endlich zu einer energischeren Reaktion durchringt, ist es die deprimierende Feststellung, dass alles auf nichts "als auf die Leere, auf die totale Abwesenheit von Sinn" hinausläuft.
Dieses fast durchgehende Verschwinden des Erzählers hinter seinen Gesprächspartnern irritiert ein wenig. Zum einen, weil er dadurch merkwürdig farblos und meinungsschwach wirkt. Zum zweiten, weil die Ich-Form, in der sowohl seine Narration als auch ihre Monologe gehalten sind, und der zum Verwechseln ähnliche Redestil aller Beteiligten die Übergänge zwischen den einzelnen Romanteilen nahezu aufhebt. Und zum dritten, weil die Äußerungen, die der Autor wegen der besagten Blässe seines Erzählers anderen Figuren in den Mund legt, manchmal zu geschliffen und gelehrt wirken.
Diese kleinen Schwächen ändern aber nichts an der Tatsache, dass Matthias Nawrat ein Roman von großer literarischer Kraft und philosophischer Tiefe gelungen ist. Sein Erzählton ist angenehm ruhig und präzise, die Leichtigkeit, mit der er, von der Alltagsbanalität eines Berliner Mikrokosmos ausgehend, eine ganze Bandbreite an universellen Gedanken und Beobachtungen zum Zustand der heutigen Welt und unserer eigenen Befindlichkeit entfaltet, zutiefst beeindruckend. Und darüber hinaus ist es ein schönes Porträt jenes Berlins, über dem der Himmel etwas weniger grell, dafür umso einladender leuchtet.
MARTA KIJOWSKA.
Matthias Nawrat: "Der traurige Gast".
Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2019. 304 S., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main