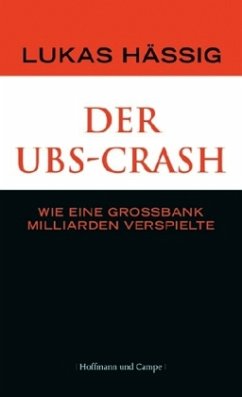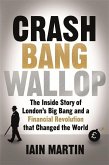"Zurich, we have a problem!" Der Notruf der Risikomanager an die Zentrale der UBS wurde ignoriert. Fast 70 Milliarden Franken, umgerechnet knapp 45 Milliarden Euro, musste die Schweiz bereitstellen, um ihre größte Universalbank - vorläufig? - vor dem Untergang zu bewahren. Die Hintergründe eines Skandals. Schauplatz des leider sehr realen Geschehens, das der Autor beschreibt, ist die große, weite Welt der Finanzindustrie. Die Akteure: zu Zockern mutierte Chefs eines mit Anlegermilliarden jonglierenden Bankenimperiums.

Drei Bücher über die Krise der Schweizer Großbank
Die Großbank UBS, einst ein Aushängeschild des Finanzplatzes Schweiz, geriet im Sommer 2007 in eine tiefe Krise. Die Subprime-Verluste in den Vereinigten Staaten, die damals ans Tageslicht kamen, weiteten sich zu einer Erschütterung aus, welche schließlich die gesamte Bank erfasste. Ende vergangenen Jahres musste der Schweizer Staat sogar ein Notpaket schnüren, um den größten Vermögensverwalter der Welt zu stabilisieren. Die Publikationen mit einer ersten Zwischenbilanz haben denn auch nicht lange auf sich warten lassen.
Am schnellsten war die Genfer Finanzjournalistin und ehemalige Analystin Myret Zaki. Sie wartet mit zahlreichen Einzelheiten zu jenen Themen auf, welche den tiefen Fall der Bank verursachten: die angelsächsische, von UBS-Patron Marcel Ospel verordnete Bankkultur, Ospels "persönliches Regiment", die Machtkämpfe und die Verblendung in der Führungsspitze sowie die unterentwickelten Kontrollinstrumente. All dies machte die UBS nicht zu einem Opfer der Finanzmarktkrise, sondern zu einem der unheilvollsten Akteure in dem Geflecht aus Größenwahn, Gier und Überheblichkeit. Alan Greenspans Notenbankpolitik des billigen Geldes bildete dabei den Boden, auf dem die Auswüchse erst gedeihen konnten.
Dabei war die UBS gewarnt. Schon kurz nach der Fusion von Schweizerischer Bankgesellschaft (SBG) und Schweizerischem Bankverein (UBS) im Jahr 1998 erlebte das neue Unternehmen mit dem Scheitern des Hedge-Fonds Long Term Capital Management (LTCM) ein erstes Desaster, das 950 Millionen Franken kostete. Dennoch dreht die Bank noch einmal ein großes Rad, dieses Mal im amerikanischen Hypothekengeschäft. John Costas, umhätschelter Star im Investmentbanking, darf im Juli 2005 den hauseigenen Hedge-Fonds Dillon Read Capital Management (DRCM) gründen, ausgestattet mit Milliarden aus der Bank.
Das verbleibende Investmentbanking rückt an die zweite Stelle und versucht danach, die DRCM-Strategie bei festverzinslichen Papieren zu kopieren. All dies beschreibt Zaki ausführlich. Im März 2007 blasen die DRCM-Händler zum Rückzug. Daraufhin bricht nach den Worten der Autorin ein Krieg mit den gedemütigten UBS-Investmentbankern aus, die auf dem eingeschlagenen Weg weitermachen wollen. Im Mai schließt der UBS-Vorstand den Hedge-Fonds und trennt sich von Costas. Zwei Monate später bricht das Subprime-Gebäude in Amerika zusammen. Umso bemerkenswerter ist daher Zakis Schlussfolgerung: "Die Bank hat Dillon Read nicht deswegen aufgelöst, um die Risiken herabzusetzen, sondern um mehr Risiko einzugehen!"
Ob dies das "größte Geheimnis" ist, das sie nach eigenen Worten in der UBS entschlüsselt hat, mag dahingestellt bleiben. Tatsache ist allerdings, dass die Bank seit Juli 2007 Verluste von rund 50 Milliarden Franken angehäuft hat, die Saat hierzu jedoch viel früher und auf verschiedenen Feldern gelegt wurde.
Nach den Erkenntnissen von Lukas Hässig über den UBS-Crash blinkten die ersten Warnlampen schon 2002. Er zitiert Risikoexperten, die auf die "riesige Verbriefungsmaschine" hinwiesen, die Investmentbankchef Costas schon damals angeworfen hatte. Es kam noch schlimmer: Ospel beschwor noch 2005 in völliger Verkennung (oder vielleicht eher Verdrehung) der Tatsachen die heile Welt einer extrem risikoscheuen UBS.
Hässig und Zaki stützen im Wesentlichen das Bild, das man von der Skandalbank schon gewonnen hat, aber man erfährt einige interessante Randaspekte. Hierzu gehört im September 2008 die offenbar verzweifelte Suche nach privaten Kapitalgebern für jene sechs Milliarden Franken, die dann der Schweizer Staat als Teil des großen Hilfspakets einschießen musste. Weiter lenkt Hässig zu Recht den Blick auf die "zweite Sturmfront", die sich in den Vereinigten Staaten zusammengebraut hat. Sie betrifft das Offshore-Geschäft mit Amerikanern aus der Schweiz heraus. Es brachte der UBS mit dem "Fall Birkenfeld" Probleme ein, zu deren Lösung sie wohl weiteres Geld in Milliardenhöhe bereitstellen muss.
Auch Claude Baumann und Werner Rutsch bleiben misstrauisch. Sie betten die UBS-Krise in den großen Zusammenhang einer Entwicklung des "Swiss Banking" seit dem Zweiten Weltkrieg ein. Diese besonders lesenswerte Darstellung weitet den Blick und vermittelt ein Gefühl für die grundlegenden Veränderungen im Umfeld, mit denen sich das "Swiss Banking" ungeachtet aller aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen muss. Weitermachen wie bisher, dies postulieren die Autoren, ist keine Strategie. Sie formulieren fünf Thesen, die den Finanzplatz als Ganzes einschließen. Diese kreisen um eine neue, aber eigentlich alte Erkenntnis: Die Stärke der Schweizer Banken liegt nicht in den Handelsaktivitäten flotter Händler, nicht in waghalsigen Finanzkonstruktionen oder in windigen Investitionen, sondern in der angestammten Paradedisziplin Vermögensverwaltung.
JÜRGEN DUNSCH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main