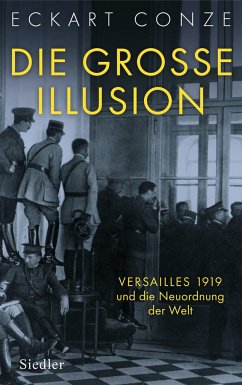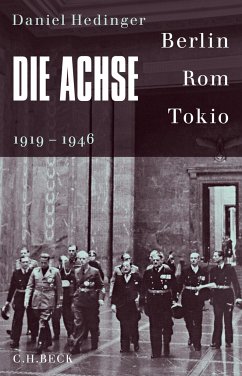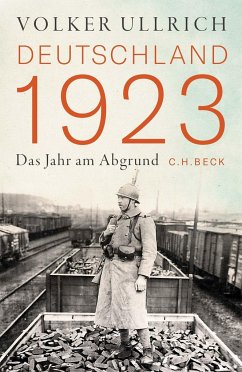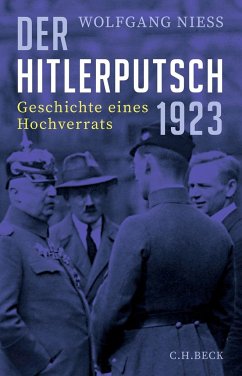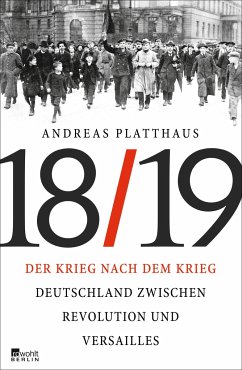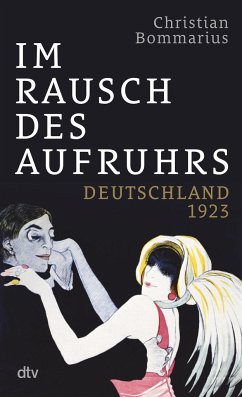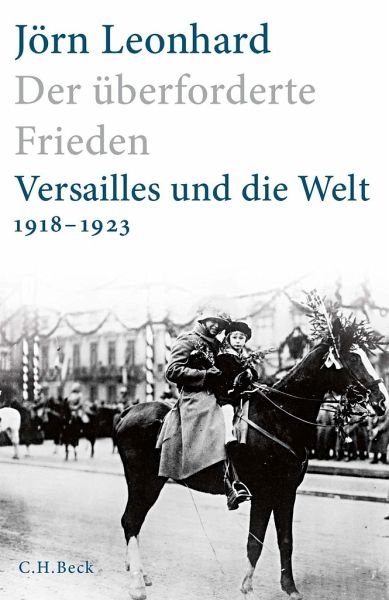
Der überforderte Frieden
Versailles und die Welt 1918-1923

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Erste Weltkrieg war ein industrialisierter Massenkrieg. Je länger er dauerte, desto mehr veränderte er die Gesellschaften, die ihn führten, und desto rasanter entwertete er das Wissen der Politiker. Wie sollte man ihn beenden? Meisterhaft und mit dem Blick für die globalen Zusammenhänge erzählt Jörn Leonhard, wie die Welt zwischen 1918 und 1923 um eine neue Friedensordnung rang und was diese Zeitenwende für den weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts bedeutete. Dabei werden die hochfliegenden Erwartungen und die teils widersprüchlichen Versprechen ebenso deutlich wie die erdrückend...
Der Erste Weltkrieg war ein industrialisierter Massenkrieg. Je länger er dauerte, desto mehr veränderte er die Gesellschaften, die ihn führten, und desto rasanter entwertete er das Wissen der Politiker. Wie sollte man ihn beenden? Meisterhaft und mit dem Blick für die globalen Zusammenhänge erzählt Jörn Leonhard, wie die Welt zwischen 1918 und 1923 um eine neue Friedensordnung rang und was diese Zeitenwende für den weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts bedeutete. Dabei werden die hochfliegenden Erwartungen und die teils widersprüchlichen Versprechen ebenso deutlich wie die erdrückenden Probleme bei der Umsetzung und die Unterschiede zwischen den Annahmen in Paris und den Realitäten vor Ort. Ob im Blick auf untergehende Reiche und neue Staaten, ethnische Minderheiten oder das neue Massenphänomen von Flucht und Vertreibung: Die Art und Weise, wie der Krieg zu Ende ging, schuf Enttäuschungen und Konflikte, die das 20. Jahrhundert prägen sollten und deren Ausläufer bis in unsere Gegenwart reichen.