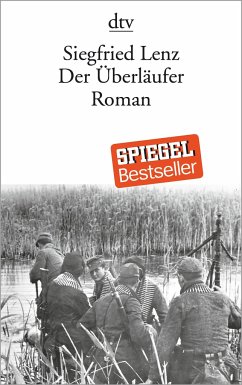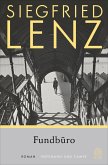65 Jahre in der Schublade - heute ein Bestseller
'Der Überläufer' ist Siegfried Lenz' zweiter Roman, geschrieben 1951. Obgleich vollendet und vom Autor mehrfach überarbeitet, blieb er bis 2016 unveröffentlicht. Zur Zeit seiner Entstehung wurde er vom Verlag aus politischen Gründen abgelehnt. Ein Überläufer zu den Sowjets als Romanheld war im Kalten Krieg nicht opportun. Eine großartige Entdeckung, ein beeindruckender Roman über den ewigen Konflikt zwischen Pflicht und Gewissen.
'Der Überläufer' ist Siegfried Lenz' zweiter Roman, geschrieben 1951. Obgleich vollendet und vom Autor mehrfach überarbeitet, blieb er bis 2016 unveröffentlicht. Zur Zeit seiner Entstehung wurde er vom Verlag aus politischen Gründen abgelehnt. Ein Überläufer zu den Sowjets als Romanheld war im Kalten Krieg nicht opportun. Eine großartige Entdeckung, ein beeindruckender Roman über den ewigen Konflikt zwischen Pflicht und Gewissen.

© BÜCHERmagazin, Melanie Schippling
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensentin Judith von Sternburg entdeckt mit dem Überläufer eine ganz neue literarische Figur, die hätte Geschichte machen sollen, in Siegfried Lenz' erst jetzt aus dem Nachlass erscheinendem zweiten Roman. Was für ein Text wäre das 1951 gewesen!, meint sie. Und heute? Wirkt der Text auf die Rezensentin entschlossen und treffsicher in seiner Darstellung einer disparaten Zeit. Die große Rückblende zurück an die Ostfront im Zweiten Weltkrieg macht Sternburg mit, staunt über das Geschick und die Ökonomie, mit der Lenz seine Figuren skizziert, und schwankt zwischen Grauen und der Wirkung furchtbarer Komik. Mitreißend scheint ihr Lenz über Verwahrlosung und Schuld im Krieg zu erzählen, perspektivisch experimentierfreudig, stark, findet sie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Erinnerungen, schwer wie Zuckersäcke: Im meisterlichen Roman "Der Überläufer" schildert Siegfried Lenz den Krieg an der Ostfront. Erst jetzt erscheint das 1952 geschriebene Buch aus dem Nachlass.
Der Lektor hat immer recht, schrieb augenzwinkernd einmal Stephen King, wohl wissend, dass ein erfolgreicher Autor die Kritik seines ersten Lesers nicht nur souverän ertragen, sondern auch schadlos abweisen kann. Zu Beginn einer literarischen Karriere aber ist das Verhältnis zwischen Autor und Lektor heikel. Dem Ideal zufolge stellt der Lektor seine Fähigkeiten selbstlos in den Dienst der Absicht des Autors, in Wahrheit hat er mit dem Verlagsvertrag im Rücken genügend Macht, bewusst oder unbewusst eigene ästhetische oder gar weltanschauliche Vorstellungen zur Geltung zu bringen. Nicht selten führt das zu Konflikten, manchmal zum Desaster.
So im Fall des jungen Siegfried Lenz. Nach der positiven Resonanz auf seinen Erstling "Es waren Habichte in der Luft" hatte Lenz 1951 bei Hoffmann und Campe einen Vertrag über einen weiteren Roman unterzeichnet, der zunächst den Titel "Da gibt's ein Wiedersehen" trug. Bereits im November wurde das Buch in einer Sammelbesprechung von Texten über den Ostkrieg von Paul Hühnerfeld lobend erwähnt. Als Lektor wurde Lenz der promovierte Germanist Otto Görner zugewiesen. Auch der zeigte sich zunächst beeindruckt von der Geschichte, die "den Leser im Genick packt". Nach einem Gespräch im Verlag übersandte er Änderungsvorschläge, "das Technische und Handwerkliche" betreffend. Lenz ging sogleich an die Überarbeitung und legte das Manuskript im Januar 1952 abermals vor, nun mit dem Titel "Der Überläufer".
In einem Gutachten für den Verlag, dessen Inhalt Görner dem Schriftsteller in Briefform mitteilte, änderte der Lektor seine Bewertung grundlegend. In einem unangenehm autoritären Ton und gespickt mit Vorwürfen stellte er das Erscheinen des Romans in der vorliegenden Form grundsätzlich in Frage. Ein Roman mit diesem Titel "hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein . . . Sie können sich maßlos schaden, da helfen Ihnen auch Ihre guten Beziehungen zu Presse und Funk nicht." Entsprechend forderte er substantielle Änderungen beim Stoff und bei der Figurenkonstellation, die auf eine Entschärfung der Überläufer-Problematik hinausliefen. Schließlich wird dem jungen Autor in einer merkwürdig linkischen Formulierung gar gedroht: "Erwägen Sie nicht etwa eine wütende Geste zu machen und ein neues Buch schreiben zu wollen."
Der Verlag wusste vermutlich damals und weiß es offenbar bis heute nicht, dass Otto Görner eine ziemlich dubiose Figur war. Er hatte in Leipzig bei dem Nazi-Volkskundler André Jolles studiert, seine akademische Karriere war aber an der Habilitation gescheitert. Görner trat der SS bei und diente dem Regime unter anderem im Heimatwerk. Nach dem Krieg setzte er sich in den Westen ab und schlug sich mit freier Tätigkeit für Verlage durch.
Der Antwortbrief zeigt den jungen Siegfried Lenz schon als den feinen Menschen, als der er zeitlebens wahrgenommen wurde. Er bedankt sich für die Bemühungen, weist aber die Unterstellungen Görners wie auch dessen Vorschläge zur Umarbeitung in sachlichem Ton entschieden zurück. An der Figur seines Helden habe er bereits zu viel geändert. Jedoch bezeichnet er den Text dann selbst als missglückt und schließt: "Vielleicht werde ich Ihnen in zwei oder drei Jahren ein neues Manuskript zeigen dürfen, ein Manuskript, das besser und ein wenig reifer ist." Das geschah nicht, jedoch hat Lenz den Text der überarbeiteten Fassung zeitlebens aufbewahrt. Er fand sich in den Materialien, die der Schriftsteller kurz vor seinem Tod 2014 dem Literaturarchiv in Marbach übergeben hatte.
Den Titel "Der Überläufer" hätte Lenz sicherlich nicht gewählt, wenn er gewusst hätte, dass der Romancier und Naturlyriker Wilhelm Lehmann, den Lenz später kennenlernte, 1927 einen Roman gleichen Titels geschrieben hatte, der freilich nie einen Verlag fand und erst 1962 in der Lehmann-Gesamtausgabe erschien. Es gibt allerdings jenseits der Thematik des Überlaufens keine Berührungspunkte. Bei Lehmann erscheint der Erste Weltkrieg in der Perspektive des Helden als ultimative Versündigung an einer mythisch überhöhten Natur. Solcher poetischen Remythisierung stand Lenz auch im Hinblick auf Lehmanns Lyrik bei aller Wertschätzung sehr skeptisch gegenüber. Bei Lenz erscheint dagegen die Landschaft als Schauplatz und immanenter Projektionsraum des Menschlichen im Guten wie im Bösen. Natur ist nicht als objektivierte da, sondern wird je in bestimmter Stimmung und Situation von Individuen wahrgenommen.
In "Der Überläufer" werden die Kriegserlebnisse des Soldaten Walter Proska erzählt, der wie sein Autor aus dem masurischen Lyck stammt. Sie spielen im letzten Sommer des Zweiten Weltkriegs. Auf der Reise vom Heimaturlaub zurück zu seiner Einheit an der Ostfront fährt der Zug im weißrussisch-ukrainischen Grenzgebiet auf eine von Partisanen gelegte Mine. Proska schließt sich zwangsweise einem von einem versoffenen Unteroffizier kujonierten Häuflein von Wehrmachtssoldaten an, das die Zuglinie sichern sollte. Zermürbt von den Angriffen der Partisanen, von Mückenschwärmen und der Sinnlosigkeit ihrer Streifengänge durch das Sumpfgebiet bei sengender Hitze, sind sie dem Wahnsinn nahe und neigen zu Übersprunghandlungen. Der eine kämpft mit einem riesigen alten Hecht, ein anderer liebt es, Bäume zu umarmen, um sie zu brechen, ein dritter schließt Freundschaft mit einem Huhn.
Hier zeigt sich bereits Lenz' Meisterschaft in der Erzeugung einer dichten Atmosphäre wie in der Figurenzeichnung. Der Krieg reduziert sich auf den engen Bezirk des Lagers, der Erzähler beobachtet die Menschen wie im Glaskasten einer Versuchsanordnung. Jeder der Männer hat eine eigene Charakteristik und Redeweise bis hinein in die Nachbildung des Dialekts, und jeder reagiert auf eigene Weise auf die sinnlose Belastung. Manche Dialoge könnten auch in einem absurden Drama stehen, wie überhaupt ein Anflug von Existentialismus durch die Erzählung weht: "Dort ist die Brücke. Kannst du jemanden sehen? / Man sieht sie nie. / Wollen wir weitergehen? fragte Proska. / Und dann? / Vielleicht erwischen wir sie. / Oder sie uns. / Was sollen wir machen? / Warten. / Worauf denn? / Bis etwas geschieht. / Und was soll geschehen? / Das kann man nicht vorher sagen."
Auch den äußersten Schrecken schildert der junge Lenz mit einer eigenartigen souveränen Distanz zum Geschehen, die aber nichts mit der Kühle eines Ernst Jünger gemein hat, viel mehr mit einem Hauch von Humor, der den Menschen noch in der widerwärtigsten Bedrängnis ihre Würde belässt. Krieg, sagt Proskas Kamerad aus Oberschlesien, ist "immer komisch. Keiner weiß, ob Leben ist Glick oder Unglick. Einer sucht Kugel und findet sie nicht, und anderer sucht keine Kugel und kriegt sie gebrannt auf Pelz. Krieg ist Iberraschung."
Lenz entfaltet die Thematik von vornherein im Bewusstsein der Zeitgenossenschaft. In einer beinahe komödiantischen Rahmenerzählung geht es um Erinnerung und Vergessen, Aufklärung und Verdrängung der Schuld. Bei einem schwerhörigen alten Apotheker will Proska sich eine Briefmarke leihen, vorher aber muss er sich, ohne selbst zu Worte zu kommen, einen Monolog des Weltkriegsveteranen zum Nutzen und Schaden der Erinnerung anhören: "Erinnerungen taugen nicht viel. Sie sind schwer wie Zuckersäcke. Wer sie ewig mit sich herumschleppt, muß eines Tages in die Knie gehen." Ausgelöst durch eine momentane Sinneserfahrung tauchen aber für ihn, ähnlich wie bei Marcel Proust, "aus dem Nebel der Zeit die Bilder seiner Erinnerung herauf".
Überhaupt verfügt der junge Lenz über das ganze Arsenal der Stilmittel des modernen Romans. In einigen Passagen werden Ereignisse geschildert, bei denen der Held nicht dabei ist, auch meldet sich gelegentlich eine übergeordnete Erzählinstanz mit sarkastisch pathetischen Kommentaren zu Wort. Der häufige Gebrauch des inneren Monologs und des Selbstgesprächs in Momenten, in denen der Held auf sich zurückgeworfen ist, kontrastiert mit einer Sicht von außen, in der Proska auch direkt angesprochen wird oder sich in der Erinnerung als "Assistent seines Gewissens" selbst zum Gegenüber wird.
Proska wird im Gegensatz zu seinem Kameraden Wolfgang, genannt Milchbrötchen, nicht als Kriegsgegner geschildert. Er erscheint als ein fähiger Soldat, der es nicht auf das Töten abgesehen hat, es aber im Notfall pflichtgemäß und ohne große Skrupel vollzieht. Sein Überlaufen zum Feind wird dennoch nicht als dramatische Gewissensentscheidung geschildert. Es vollzieht sich wie unwillkürlich als Bejahung des Lebens. Proska hatte schon im Zug die polnische Partisanin Wanda kennengelernt, die dann immer wieder in seiner Nähe auftaucht. An einem ruhigen schönen Abend, an dem der Frieden der Landschaft den Krieg vergessen ließ, hatte er sie geschwängert und ihr die Zukunft versprochen. Vordergründig aber ergibt er sich den Partisanen, weil er im Kämpfen keinen Sinn mehr sieht.
Sein unbedachter Versuch der Fraternisierung wird zunächst schroff abgewiesen, er muss sich die Verachtung derer gefallen lassen, die zu allem entschlossen den Tod nicht fürchteten. "Sobald ihr besiegt seid, wollt ihr Brüder sein. Das kennen wir. Erst wenn ihr Gnade braucht, wenn euch das schmutzige Leben teuer wird, wenn ihr Angst bekommt, dann redet ihr von Brüderlichkeit. Solange ihr die Herren seid, sch . . . ihr auf Demut und Barmherzigkeit." Proska empfindet Scham, was ihn aber schließlich zum Überlaufen bewegt, bleibt eigenartig diffus. Es scheint nicht nur die für den nächsten Tag erwartete Erschießung zu sein, die ihn an der Seite des pazifistischen Kameraden die Seite wechseln lässt.
Der letzte Teil des Romans spielt in der Sowjetischen Besatzungszone. Die Beschreibung eines Büros, aus dem immer wieder Menschen verschwinden, erinnert an Kafka: "Er hatte nicht die Macht, das zu ändern, er wusste nicht einmal, wer für diese Veränderungen verantwortlich war, aber sie geschahen und folglich musste es jemanden geben, der sie verfügte." In wenigen Strichen entwirft Lenz die Atmosphäre der Überwachung bei der Formierung des totalitären Systems der DDR.
Im Nachhinein ist schwer zu begreifen, warum Siegfried Lenz diesen fesselnden Roman, der schon alle Facetten seiner erzählerischen Meisterschaft und der Bildkraft der Sprache aufweist, lebenslang liegen ließ. Allenfalls legt sein Antwortbrief an den Lektor nahe, dass es sich um einen Akt des schönen Trotzes gegen ein Hineinreden aus unlauteren Motiven gehandelt hat. Dass er nun doch noch erscheint, ist ein postumer Triumph eines Autors, der Aufklärung und poetische Intensität unvergleichlich zu verbinden wusste - und ein großes Glück für passionierte Leser.
FRIEDMAR APEL
Siegfried Lenz: "Der Überläufer". Roman.
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2016. 368 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»So wird dieser in beispielhaft schönem Deutsch verfasste Roman, das reife Werk eines jungen Mannes, erst jetzt publiziert.« Franziska Augstein Süddeutsche Zeitung, 27./28.02.2016