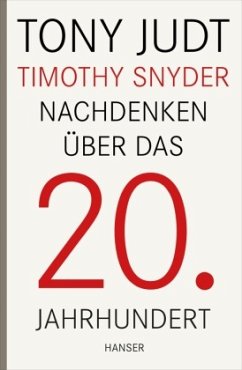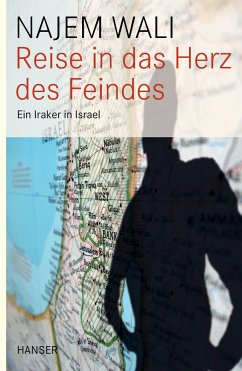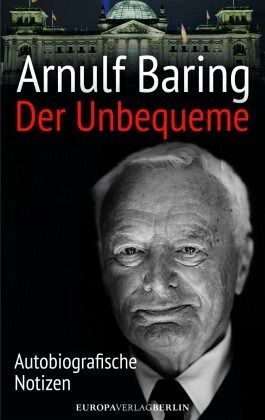
Der Unbequeme
Autobiografische Notizen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Arnulf Baring, Jurist, Zeithistoriker, Politikwissenschaftler und Publizist, scheut sich nicht, den Meinungskonformismus politischer Korrektheit mit unbequemen Wahrheiten zu konfrontieren. So liest sich seine Autobiografie auch als scharfsinniger Kommentar zur jüngeren deutschen Geschichte. Baring entwirft das Bild einer beschädigten Nation, die bis heute um ihre Identität im Schatten des Dritten Reiches ringt. Eindringlich warnt er vor der Selbstaufgabe der Deutschen im Namen einer verfehlten Europapolitik und plädiert für die Rückbesinnung auf einen aufgeklärten Patriotismus.
Für ein Ende der Redeverbote - unter diesem Motto beleuchtet Arnulf Baring Schlüsselszenen seiner Biografie. Auf spannende Weise wird nachvollziehbar, wie seine persönlichen Erlebnisse und seine manchmal provozierenden Thesen miteinander verschränkt sind. Ausführlich erzählt er von seiner Kindheit im Dritten Reich, von Paraden und Bombennächten, aber auch von familiären Prägungen und bürgerlicher Normalität. Er schildert das politische Klima der Nachkriegsjahre, seine Erfahrungen als international geschätzter Hochschullehrer und seine Zeit im Bundespräsidialamt, die ihn zum exponierten Chronisten der Ära Brandt/Scheel machte. Zugleich ist das Buch eine meinungsfreudige, höchst aktuelle Bilanz des politischen Essayisten. Zu den Reizthemen gehören Fragen der deutschen Identität im Spannungsfeld von historischer Schuld und gegenwärtiger Krise der europäischen Union sowie Anmerkungen zum politischen und privaten Alltag als Spiegel gesellschaftlicher Verwerfungen. Damit gibt Baring ebenso berraschende wie aufschlussreiche Einblicke in den intellektuellen Kosmos seines Denkens und erweist sich nicht zuletzt als großartiger Erzähler. Schon Sebastian Haffner urteilte ber ihn: "Er ist vielleicht das größte Erzähltalent unter heute schreibenden deutschen Historikern; es ist unmöglich, von Baring nicht gefesselt zu sein."®