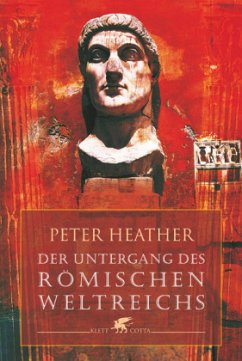Der geheimnisvolle Tod der Westhälfte des Imperiums zählte zu den grundlegenden Revolutionen der Geschichte, zu einer Folge von Ereignissen, die die Welt profund veränderten. Peter Heather fordert die herkömmliche Ansicht von einem korrupten, überfeinerten, christianisierten Reich heraus, dessen Tage gezählt waren. Mit Einbeziehung jüngster archäologischer Entdeckungen und einer radikalen Neulektüre klassischer Texte hat er eine aufsehenerregende, neue Geschichtserzählung über diese Zeit verfasst.
Sich auf seine unvergleichlichen Kenntnisse der Barbarenvölker stützend, unter umfassender Zuhilfenahme der Ergebnisse jüngster archäologischer Entdeckungen und einer radikalen Neulektüre klassischer Texte hat Heather eine spannende, Aufsehen erregende und neue Geschichtserzählung über diese Zeit verfasst.
Zum einen ist dies eine unterhaltende und provozierende Reise durch die Welt des vierten und fünften Jahrhunderts; es handelt sich aber auch um einen epischen Bericht über Zivilisationen (Germanen, Hunnen und Parther), die um ihr Überleben kämpfen. Rom stürzte, so legt Heather dar, nicht wegen seiner Schwäche, sondern durch die Summe der Kräfte, die durch seinen gigantischen Erfolg freigesetzt wurden.
Sich auf seine unvergleichlichen Kenntnisse der Barbarenvölker stützend, unter umfassender Zuhilfenahme der Ergebnisse jüngster archäologischer Entdeckungen und einer radikalen Neulektüre klassischer Texte hat Heather eine spannende, Aufsehen erregende und neue Geschichtserzählung über diese Zeit verfasst.
Zum einen ist dies eine unterhaltende und provozierende Reise durch die Welt des vierten und fünften Jahrhunderts; es handelt sich aber auch um einen epischen Bericht über Zivilisationen (Germanen, Hunnen und Parther), die um ihr Überleben kämpfen. Rom stürzte, so legt Heather dar, nicht wegen seiner Schwäche, sondern durch die Summe der Kräfte, die durch seinen gigantischen Erfolg freigesetzt wurden.

Ein großer Wurf der Geschichtswissenschaft: Peter Heather erzählt souverän vom Untergang des römischen Imperiums / Von Uwe Walter
Peter Heather legt nicht nur Zusammenhänge offen und erzählt faszinierende Geschichten, er fordert auch Gerechtigkeit ein.
Nicht zufällig war es die Zeit der Aufklärung, als Edward Gibbon sein Meisterwerk über den Niedergang und Sturz des Römischen Kaiserreichs schrieb. Zwar führte er die Erzählung bis zur türkischen Eroberung Konstantinopels, doch rechtliche oder historische Kontinuitäts- und Translationskonstruktionen interessierten ihn wenig. Hingegen teilte er die Überzeugung seiner Epoche, die ein gutes Leben an bestimmte Voraussetzungen gebunden sah: Bildung und Austausch, Wohlstand und Konsum, Ordnung und Sicherheit, alles entfaltet im Schutz einer stabilen, aber nicht erdrückenden Staatsgewalt. Wenn all dies dahin ist, spielt es keine Rolle mehr, welchen Namen die Krone trägt und wie sich ihr Träger sonst legitimiert. Und von diesem Zusammenhang her gewinnt die Rede vom Untergang des Römischen Reiches, die so leicht intellektuell verächtlich zu machen ist, ihr humanes Recht. Bryan Ward-Perkins hat das jüngst mit erfrischender Polemik gegen verbreitete Beschönigungen noch einmal unterstrichen (F.A.Z. vom 13. Juni).
Auch Peter Heather greift die Frage auf und wundert sich mit vielen vor ihm, wie ein solches Zivilisationsgehäuse, das Zentralheizungen und Banken, Verwaltungshandbücher und Waffenfabriken besaß, von illiteraten Barbaren mit einer Vorliebe für dekorative Sicherheitsnadeln in die Knie gezwungen werden konnte - zumindest im Westen, wo gegen Ende des fünften Jahrhunderts das Reich als politischer Referenzpunkt einfach erlosch. Anders als Generationen früherer Historiker sucht der Oxforder Gelehrte nun selbstverständlich nicht länger Schuldige, etwa dekadente, ignorante, von christlicher Weltflucht oder dem Bleiweiß ihrer Wasserleitungen entkräftete Römer oder raublustige, dabei von den Gesetzen der klassischen Mechanik in Bewegung gesetzte Invasoren. Doch auch der aktuelle kulturalistische Gegenentwurf, der die Katastrophe ausblendet und lieber Miniaturbilder von Askeseathleten und Wahrsagern, Kinderkaisern und Kirchenvätern liefert, befriedigt ihn nicht. Vielmehr kehrt er zu Gibbons Vorbild der Erklärung durch Erzählung zurück, unterstützt von ausgezeichneten Karten. Die Disposition ist klassisch: Zunächst werden Römer und Barbaren als Akteure vorgestellt, mit weitem Rückgriff auf die Zeit Caesars. Ein Kapitel über die Grenzen des Regierungshandelns kündigt Bedrohungen und Peripetien an. Dann die Krisen, zunächst an der Donau, dann in Gallien, schließlich der Verlust Nordafrikas und die Neuformierungen, die Attilas Vorstoß nach Westen bei seinen Nachbarn auslöst, auch wenn seinem Reich nur ein kurzes Leben beschieden ist. Am Ende unvermeidbar die Katastrophe, mit einigen Überlebenden und vielen Fragen.
Doch das Desaster kam nicht zwangsläufig, wie allein schon das Überleben des Oströmischen Reiches zeigte, das ebenfalls schwer bedroht war, aber seine wichtigsten Ressourcen besser zu verteidigen wusste. Heather räumt auf mit dem Mythos, das Imperium sei nicht reformfähig gewesen. Vielmehr berichtet er von einem Reich, das im vierten Jahrhundert stark war und in seinen ländlichen Regionen blühte, an dessen Rändern sich aber neue Mächte formierten. Der Blick hat sich also erneut auf die Barbaren zu richten. Sie abzuwehren oder mindestens einzuhegen bedurfte vermehrter römischer Anstrengungen, die ihrerseits das prekäre Gleichgewicht zwischen der Zentrale und den Städten als den Trägern von Romanitas, Wohlstand und politischer Selbstverantwortung zum Kippen brachten. Die Machtverlagerung von den Städten auf die Armee und die Reichsbürokratie war dennoch so lange unproblematisch, wie diese funktionierten, also Schutz boten, ohne allzu gefräßig zu sein. Als das nicht mehr der Fall war und die angestammte Ideologie der Überlegenheit keine Verankerung in der Wirklichkeit mehr besaß, mangelte es den Akteuren in den gepeinigten Provinzen schlicht an Mitteln und Motivation, weiterhin in großem Stil Römisches Reich zu sein.
Die aufregenden Modernisierungen spielten sich gewiss außerhalb des Reiches ab, doch zugleich unter dem Einfluss der Schwerkraft und Logik seiner Macht. Selten hat man je so spannend erklärt gefunden, wie nomadische Hunnen und ackerbauende Germanen ihre Kampfkraft als Chance erkannten, von den Römern Geld zu erhalten, sei es in ihren Diensten oder durch Erpressung, und wie das Geld eine Machtbildung, ja eine umfassende politische Revolution ermöglichte. Das "Hunnenreich" war in diesem Sinne keine Gebietsherrschaft, sondern der Versuch, möglichst viele Krieger unter dem Namen Attilas zu vereinen. Kurzfristig, zu Beginn des fünften Jahrhunderts, nutzte dieses Aufsaugen von Goten und vielen anderen Völkern sogar dem Reich. Doch die Ruhe war trügerisch. "Zum ersten Mal in der Geschichte des Römischen Reiches konnten die Hunnen einen großen Teil der europäischen Nachbarn Roms zusammenfassen, wodurch so etwas wie eine konkurrierende imperiale Supermacht entstand." Zwar konnte Rom Attilas direkten Angriff in der Mitte des fünften Jahrhunderts abwehren, doch die indirekten, gleichsam katalytischen Folgen des Vorstoßes der Hunnen waren wesentlich gravierender. Auf dem Balkan und in Gallien wurden die Grundbesitzer schwer getroffen, Britannien ging verloren, vor allem aber Spanien und Teile Galliens an Sueben, Westgoten und Burgunder. Außerdem bekam das Reich keine Hand frei, um mit Nordafrika die Provinz zurückzuerobern, von deren Steueraufkommen und Getreide die Stabilität des ganzen Westens abhing. Mit Geschick und Glück konnten die Vandalen unter Geiserich und seinen Nachfolgern ihre Beute verteidigen, und am Ende verblieb der Zentrale kaum mehr als der Besitz Italiens.
Fast noch schlimmere Folgen zeitigte am Ende aber paradoxerweise der Zusammenbruch des Hunnenreiches um 460, denn als Zerfall eines Gefolgschaftsverbandes entließ er mehrere hochmilitarisierte Gruppen auf engem Raum in einen Kampf um Macht und Ressourcen, den Rom nicht mehr kontrollieren konnte. Im Jahrzehnt nach 470 schließlich begriff man vielerorts trotz einer verbreiteten politischen und kulturellen Unbeweglichkeit, die eine Welt ohne Rom nicht vorstellbar erscheinen ließ, dass das Westreich nicht länger existierte. Als kein Geld, keine Waffen und keine Befehle mehr kamen, gingen die Soldaten an der Donau und anderswo nach Hause, bemüht, zu überleben und als Milizen ihre befestigten Dörfer zu verteidigen. Wunder wurden jetzt nur noch von Männern wie dem heiligen Severin erwartet, und die neuen Herren, ob Angeln oder Sachsen, Rugier oder Heruler, legten wenig Wert auf lateinische Verse und gute Manieren. In anderen Regionen wie etwa in Gallien, wo es Städte mit Bischöfen, wehrhafte Aristokraten und lernwillige Franken mit Sinn für Steuern, Gesetze und Institutionen gab, blieb die Romanitas erhalten, wenngleich in reduzierter und veränderter Form. Für das Christentum schließlich, das durch Konstantin in der Reichskirche ein festes Gebäude gefunden hatte, bedeutete das Wegbrechen der schützenden, aber auch vereinheitlichenden Zentralgewalt einen tiefen Wandel, langfristig aber auch eine große Chance, die genutzt wurde. Alles hing nun wieder an den Bischöfen in ihren Mikrokosmen, und mit dem Verlust der literarischen Bildung konnten Laien in theologischen Fragen nicht länger mitdiskutieren, ja am Ende nicht einmal mehr die Bibel lesen. Die Kleriker behaupteten dagegen die Bildung und damit das Deutungsmonopol - bald nicht mehr allein in geistlichen Dingen.
Wie Heather die Rekonstruktion eines verwickelten systemischen Zusammenhangs und seiner einzelnen Phasen zu Akten einer historischen Tragödie macht, das erklärt einen Teil der intellektuellen Faszination, die sein Bericht ausstrahlt. Hinzu kommt: Er handelt zwar von einer fernen Zeit, doch zugleich von Globalisierung und Migration, von Wanderungen, die nicht zufällig waren, sondern sich aus dem Wohlstands- und Zivilisationsgefälle zur damaligen Ersten Welt ergaben, und von Modernisierungen, die für die neuen Gruppen ungeahnte Ansprüche und Optionen mit sich brachten und zugleich ihre Führer unter vielfältige Zwänge setzten. Je mehr sich alte ethnisch-moralische Gewissheiten über Römer, Goten und Hunnen auflösen, desto spannender lesen sich die Miniaturen über Diplomaten, Kinderkaiser und Panegyriker, Heermeister und Grundbesitzer, belogene Herrscher und überforderte lokale Befehlshaber, aber auch über die Leuchttürme der Epoche wie Aetius, Alarich und Attila.
Heather legt aber nicht nur Zusammenhänge offen und erzählt faszinierende Geschichten, er fordert auch Gerechtigkeit ein. Nicht für eine ganze Epoche, denn das wäre logischer Unsinn, wohl aber für einzelne Gestalten, die im Chaos des Zusammenbruchs ihrer Welt weiterhin Bildung und Kultur zu leben suchten. Wohl liest sich ihr Latein geschraubter und bemühter als das eines Caesar oder Horaz. Doch Vorsicht mit abschätzigen Urteilen: Ein Zeitalter, so Heather bissig, "das mit der Kettensäge bearbeitete Kühe in Konservierungsmittel als Kunst betrachten kann, ist per definitionem außerstande, andere künstlerische Bemühungen nach überzeitlichen Standards zu beurteilen".
Peter Heather: "Der Untergang des Römischen Weltreichs". Aus dem Englischen von Klaus Kochmann. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2007. 640 S., 16 Seiten Farbtafeln, geb., 34,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
An der Frage, warum das Römische Reich unterging, haben sich die Historiker seit Jahrhunderten die Zähne ausgebissen und die unterschiedlichsten Antworten gefunden, meint Stefan Rebenich. Für Peter Heather hat der Einfall der Hunnen und die in der Folge geschwächte militärische, ökonomische und politische Lage das Ende des römischen Imperiums besiegelt, wie er in seinem umfangreichen Band äußerst fesselnd darlegt, so der Rezensent anerkennend. Ihm imponiert der beherzte Revisionismus, mit dem der britische Historiker ältere Theorien zu widerlegen sucht und er weiß zu schätzen, dass sich Heather nicht auf allzu einfache Erklärungsmodelle einlässt. Der Autor stütze sich bei seinen Thesen auf die historischen und archäologischen Forschungsergebnisse und versuche, die "Ereignisgeschichte" Roms zu rekonstruieren, erklärt Rebenich einverstanden. Dabei ist, wie er lobt, in der "besten Tradition" britischer Geschichtsschreibung ein packendes Buch herausgekommen, das zudem auch in der deutschen Übersetzung gut lesbar ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH