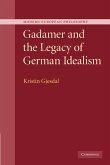Jacques Derrida und Hans-Georg Gadamer lernten sich in den frühen 80er Jahren kennen, und seit dieser Zeit entspann sich eine kontroverse Auseinandersetzung über die Hermeneutik, die Kunst der Interpretation, insbesondere über die Endlichkeit unseres Verstehens. Als Gadamer starb, hielt Derrida im Februar 2003 die Festrede zur Gedenkfeier der Universität Heidelberg. Mit einer eindringlichen Celan-Lektüre führt Derrida vor, wie das Gespräch mit Gadamer über seine letzte Unterbrechung hinaus am Ende zu einem 'ununterbrochenen Dialog' werden könnte. Dem Band beigefügt sind Kommentare Gadamers zu Celans Gedichtfolge Atemkristall sowie Materialien aus der Zeit der ersten Begegnung. In Derridas Reflexion über den Abschied und das Abschiednehmen kommt es hier zu einer letzten, vielleicht entscheidenden Annäherung.

Die Hermeneutik von Kontinuität und Bruch: Jacques Derrida und Hans-Georg Gadamer im Gespräch über einen Vers
Das Verhältnis zwischen Jacques Derrida und Hans-Georg Gadamer läßt sich beschreiben als das einer spannungsvollen Schwebe. Beiden gilt die Sprache als Ausgangsbasis ihres philosophischen Unternehmens, beide bestreiten das Erkenntnisprivileg der methodischen Wissenschaften, und beide orientieren sich an der Kunst, wenn es um die Rechtfertigung einer anderen Form von Erkenntnis geht. Aber sie enden in unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Richtungen. Während Gadamer untrennbar mit der Philosophie der Hermeneutik als einer Grundlegung des Verstehens verbunden ist, praktiziert Derrida im Namen der Dekonstruktion die Subversion aller Grundlegungsversuche. Während der eine in der Sprache, das heißt im Gespräch, einen wenn auch schwankenden Boden der Verständigung findet, tun sich für den anderen in der Sprache, das heißt nun in der unendlich rekombinierbaren Zeichenkette, letztlich nur Abgründe der Bedeutung auf.
Es kann daher auch nicht überraschen, daß das erste persönliche Zusammentreffen der beiden Philosophen 1981 in Paris mehr von Verständigungsproblemen als von Verständigung gekennzeichnet war. Mehrere Treffen waren nötig, in Heidelberg, auf Capri und nach zehn Jahren ein weiteres Mal in Paris, bis ein wirkliches Gespräch, ein Dialog begann.
So beschreibt es nun auch Derrida in seiner Festrede zur Gedenkfeier an Gadamer, die er im Februar 2003 in Heidelberg gehalten hat. Der Dialog zwischen beiden beginnt mit einer Unterbrechung, noch bevor er recht begonnen hat. Aber als "innerer Dialog" setzt er sich fort, während gewissermaßen kompensatorisch eine Reihe von Philosophen, besonders in den Vereinigten Staaten, dieses Gespräch in seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten über die Jahre fortspinnen.
Mit seiner Gedenkrede beendet Derrida diese realen und virtuellen Gespräche. Freilich nicht, ohne dieses Ende gleich wieder aufzuheben. Denn es ist ein "ununterbrochener Dialog", der da zwischen ihm und Gadamer stattfindet. Der doppelte Bruch, der im Wort "ununterbrochen" steckt, ist mit Bedacht gewählt. Es bedarf erst des Bruchs, um letztlich keinen Bruch entstehen zu lassen. Das ist, wie immer bei Derrida, nicht mit Hegel, sondern mit der Romantik, nicht dialektisch, sondern paradox gedacht. Doch jenseits dieser Etikettierung ist das Bemühen zu bemerken, dem Recht der Hermeneutik wie der Dekonstruktion zu entsprechen.
Denn es geht Derrida, beinahe erwartungsgemäß, nicht nur um eine persönliche Abschiedsrede an den verstorbenen Gesprächspartner, getragen von "Bewunderung" und "Melancholie" (mit Freud: der Weigerung, den Tod des Anderen zu vergessen). Sondern es geht ihm um nicht weniger als um eine erneute Antwort auf die Frage, inwiefern Verstehen möglich ist. Der Andere, den es im emphatischen Sinn zu verstehen gilt, ist ein Lebewesen mit Besonderheiten und Eigenarten, ja sogar, je genauer man hinsieht, einzigartig und unverwechselbar. Doch zu sagen, was einen Menschen im Innersten zusammenhält, ist, schon der alltäglichen Intuition nach, ein unmögliches Unterfangen.
Um es dennoch in Angriff zu nehmen, wählt Derrida ein Medium, das verschiedene, argumentationsstrategisch nützliche Eigenschaften in sich vereint: die Lyrik. Denn sie ist sprachlich verfaßt, gilt als Kunst, im gelungenen Fall als einzigartig und kann schon deshalb als Mittler zu Gadamer fungieren. Sie kann das um so besser, wählt man einen Lyriker, dessen Gedichte nicht nur Derrida, sondern auch Gadamer sehr schätzt. Dieser verbindende Lyriker ist Paul Celan, und als hervorgehobenen Vers, um den die Interpretation kreist, wählt Derrida: "Die Welt ist fort, ich muß dich tragen."
Die Interpretation wird zum Exemplum der Stärke und Schwäche der Hermeneutik und damit der Nähe und Ferne zu Gadamer. Denn in diesem Vers sieht Derrida wiederum eine Paradoxie am Werk. Was ihn mit Gadamer eint, wird zum Anlaß der Entzweiung. Beide erweisen sich als Schüler Heideggers in der Wertschätzung des Dichtens als jener ausgezeichneten Form des Denkens, das den Menschen inmitten der allgemeinen, von der Wissenschaft noch verschärften Weltverstellung überhaupt erst wieder einen Weltzugang eröffnet. Die Gedichtzeile Celans versteht Derrida aber nun, ganz im Sinne der gesamten poststrukturalistischen Lektürestrategien, als selbstbezügliches Bekenntnis des Gedichts. Als hermetisches erschließt es nicht mehr, sondern entzieht die Welt.
Und darauf kann, so Derrida, eine Textauslegung nicht mehr nach dem Muster der Hermeneutik reagieren. Auch sie weiß, daß gerade der endlose Prozeß des Verstehens die Zukunft dessen sichert, was verstanden werden soll. Denn die endgültige Deutung wäre Stillstand, gewissermaßen der Tod des zu Deutenden. Aber diese Einsicht ist dem Dekonstruktivismus zuwenig. Seine Konsequenz aus der Hermetik, aus der systematischen Antwortverweigerung des Textes besteht darin, diesen mit immer neuen und immer anderen Deutungen, dem, was Derrida "Aufpropfungen" nennt, zum Wuchern zu bringen. Und so geschieht es auch im Falle Celans. Daß Derrida damit die Geduld seiner Leser- und Zuhörerschaft wieder arg strapaziert, ist ihm bewußt.
Am Ende aber bleibt einerseits die hermeneutische (und mittlerweile auch durch Donald Davidson reformulierte) Einsicht, daß noch der Dissens Einverständnis voraussetzt, um überhaupt als Dissens wahrgenommen werden zu können. Andererseits setzt ein wahres Einverständnis, schon um die Individualität des Anderen zu wahren, den Bruch der Beziehung voraus. Es darf keinen ungebrochenen, ununterbrochenen Bezug zum Anderen geben. Das ist die Ethik von Dekonstruktivismus und Hermeneutik gleichermaßen.
JOSEF FRÜCHTL.
Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer: "Der ununterbrochene Dialog". Herausgegeben und mit einem Nachwort von Martin Gessmann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 111 S., br., 9,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ralf Konersmann hat diesen Band, der hauptsächlich Jacques Derridas Gedenkrede über den verstorbenen Hans-Georg Gadamer enthält, zugleich als "Reverenz, Abschied und Selbstverständigung" gelesen. Nicht zuletzt aber ist es das Dokument einer "einzigartigen Geistesverwandtschaft", das über 25 Jahre hinweg eine Auseinandersetzung zwischen "Hermeneutik und Dekonstruktion" belegt, so der Rezensent angetan. Da Derrida als "thematischen Bezugspunkt" seiner Rede einige Verse von Paul Celan ausgewählt hat, erscheint es Konersmann als ausgesprochen "glückliche Entscheidung" des Herausgebers Martin Gessmann, auch den Kommentar zu Celans "Atemkristall" von Gadamer in diesen Band aufzunehmen, denn das Nebeneinander der beiden Texte "ermöglicht die schönsten Entdeckungen", wie der Rezensent schwärmt. Wenn Derrida vom "Unheimlichen" schreibt, wird zwar auch hier die "Geistesverwandtschaft" der beiden Philosophen deutlich, doch "heimelig" wird es trotzdem nicht, so Konersmann erfreut. Er feiert den Band als Derridas "innigste Huldigung und genaueste Kritik" und er hebt auch den "klugen" Kommentar des Herausgebers lobend hervor.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH