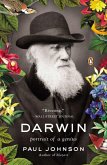Schönheit, so meinte man lange zu wissen, habe in der Evolution nichts zu suchen, sei bestenfalls schmückende Zutat oder Handicap beim Kampf ums Überleben. Heute wissen wir: Schönheit ist nicht nur "Äußerlichkeit", sondern verweist auf ein inneres Potential. Weit davon entfernt, lediglich Anpassung zu sein, ist sie ein echter Ausdruck von Individualität.
In seinem neuen Buch zeigt der bekannte Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf, wie eng die natürliche mit der sexuellen Auslese zusammenhängt, bei der Attraktivität die entscheidende Rolle spielt. Seine Schlussfolgerung: Schönheit und Schönheitsempfinden haben klare biologische Funktionen. Schon Tieren müssen wir Ästhetik zubilligen. Und auch die Rolle, die sie in der Evolution des Menschen spielt, bedarf einer radikalen Neubewertung. Die Kunst, so hat der französische Filmemacher François Truffaut einmal gesagt, bestehe darin, mit schönen Frauen schöne Dinge zu tun. Sollte er damit auch die Grundlagen des Ästhetischen beimMenschen beschrieben haben?
In seinem neuen Buch zeigt der bekannte Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf, wie eng die natürliche mit der sexuellen Auslese zusammenhängt, bei der Attraktivität die entscheidende Rolle spielt. Seine Schlussfolgerung: Schönheit und Schönheitsempfinden haben klare biologische Funktionen. Schon Tieren müssen wir Ästhetik zubilligen. Und auch die Rolle, die sie in der Evolution des Menschen spielt, bedarf einer radikalen Neubewertung. Die Kunst, so hat der französische Filmemacher François Truffaut einmal gesagt, bestehe darin, mit schönen Frauen schöne Dinge zu tun. Sollte er damit auch die Grundlagen des Ästhetischen beimMenschen beschrieben haben?

Wie kommt der Pfau zu seinen prächtigen Schwanzfedern? Der Biologe Josef Reichholf wirft einen neuen Blick auf das Konzept der sexuellen Selektion.
Von Helmut Mayer
Beim Anblick eines Pfauenschwanzes, so gestand Charles Darwin in einem kurz nach Veröffentlichung der "Origins of Species" verfassten Brief, würde ihm schlecht. Zwar befürchtete Darwin damals durchaus nicht mehr, dass seine Theorie der natürlichen Auslese über die zweckvolle Einrichtung von Organismen und Organen stolpern könnte - des Auges etwa, das ein beliebtes Beispiel für eine vermeintlich höheren Orts gestiftete Konstruktionsleistung war. Aber dafür beunruhigten ihn andere "Besonderheiten" gerade deshalb, weil sie sich offenbar nicht als Anpassungen zugunsten höherer Überlebenstauglichkeit erklären ließen.
So wie die Schmuckfedern des männlichen Pfaus, die nicht nur lang sind und farbenprächtig, sondern überdies eine äußerst kunstvoll anmutende ornamentale Zeichnung aufweisen. Gerade auf eine solche Zeichnung verwies einige Jahre später ein Kritiker Darwins: Nimmermehr sei die mit subtilen Schattierungseffekten erreichte Plastizität der Augenornamente auf den Schwanzdeckenfedern des Argusfasans durch eine zufallsgetriebene Entwicklung zu erklären. So wenig wie die schimmernden Prachtgefieder der Kolibris und alle die anderen sich aufdrängenden Beispiele einer in Formen und Farben luxurierenden Natur.
Die "Augen" des Argusfasans wusste Darwin zu entschärfen, indem er eine Möglichkeit ihrer schrittweisen Herausbildung minutiös nachzeichnete. Aber seine eigentliche Antwort auf das Problem der offenbar auf den Pfaden der natürlichen Selektion nicht erreichbaren Farben und Formen war die Idee der sexuellen Selektion, die schon früh bei ihm auftauchte und dann in "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" ihren großen Auftritt bekam: dass nämlich die luxuriös anmutenden Schmuckformen ein Selektionseffekt seien, der durch Wahl beim Paarungsakt zustande komme. In der Mehrzahl der Fälle - so wie beim Pfau - durch die Wahl der Weibchen, die jene Männchen bervorzugen, bei denen der arttypische Schmuck besonders überzeugend ausgeprägt ist. Womit die Weibchen über die Generationen hinweg einen Züchtungseffekt hervorbrächten, der aus den Bahnen der natürlichen Selektion, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ausbrechen kann.
Darwin war der Ansicht, dass man die Weibchen dabei tatsächlich als ästhetisch beeindruckbar ansehen könne. Nicht so wie wir zwar, die wir viele der ins Auge gefassten Formen ebenfalls als ansprechend und schön empfinden, doch immerhin schon auf dieser Spur. Weshalb Darwin vom Geschmack der Weibchen am Schönen schrieb, von ihrer Empfänglichkeit auch für die Reize des Neuen oder der Abwechslung und damit bereits im Tierreich "Caprice" und "Mode" auf dem aufsteigenden Ast sah. Eine für Darwin bezeichnende und einnehmende Annäherung zwischen Tier und Mensch, die Marx umgehend als Rückprojektion gesellschaftlicher Verhältnisse in die Naturgeschichte entschlüsselte.
Aber nicht nur der Ideologiekritiker ging auf Distanz, auch die moderne Evolutionsbiologie folgte Darwins Interpretation durchaus nicht. An der Tatsache der sexuellen Selektion wurde zwar nicht gerüttelt, aber ihr Mechanismus wird in den modernen Deutungen eng an die "fitness" der Individuen angedockt. Weibchen lassen sich demnach von Ornamenten, Gesängen oder anderen Balzveranstaltungen nicht einfach so beeindrucken, sondern benutzen sie in der einen oder anderen Weise als Indikatoren für die körperliche Verfassung der Männchen und deren erwartbaren Beitrag zur Sicherung von überlebensfähigem Nachwuchs. Womit die auf den ersten Blick luxuriösen Verausgabungen in Formen und Verhaltensweisen wieder eingefangen sind von der grundlegenden Ökonomie der Nachwuchssicherung.
Der Biologe Josef Reichholf folgt mit seiner Interpretation der sexuellen Selektion, der ein Großteil seines neuen Buchs "Der Ursprung der Schönheit" gewidmet ist, dieser Grundtendenz. Aber wer andere Bücher dieses längst einem größeren Publikum geläufigen Autors kennt, wird sich nicht wundern, dass er dabei eigene Wege geht und einige grundlegende Auffassungen gegen den Strich bürstet.
Fragen genug sind ja zu klären. Warum zeigt die eine Art prächtige Männchen und tarnfarbene Weibchen, während die andere gleich nebenan mit einem Erscheinungsbild für beide Geschlechter durchkommt? Warum gibt es in der artspezifischen Ornamentierung im ersteren Fall nicht mehr Unterschiede, wenn sie für den Paarungserfolg ausschlaggebend sein soll? Wie soll man sich ihre Herausbildung als evolutionär erfolgreichen Pfad vorstellen (nämlich ohne auf den Darwinschen Geschmack der Weibchen an Abwechslung zurückzugreifen)? Sind sie überhaupt, wie viele Interpretationen annehmen, unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Auslese wegen ihrer Aufwendigkeit und Auffälligkeit abträglich? Und was wählen die Weibchen überhaupt?
Reichholf nähert sich seinen Antworten über die Betrachtung des fast schon emblematischen Pfaus, aber genauso von Enten, Schwänen und Gänsen, Rotwild, Elchen und Löwen, Singvögeln und Kolibris und noch einigen Tieren mehr. Sein Leitfaden dabei ist, sich den Beitrag beider Geschlechter zur Sicherung von Nachwuchs anzusehen, die jeweiligen Investitionen möglichst genau zu bilanzieren und die Wechselwirkung der sehr verschiedenen Paarungs- und Aufzuchtstrategien mit den ökologischen Randbedingungen immer im Auge zu behalten - so wie es neuere verhaltensökologische Untersuchungen vorführen und dabei eindrucksvoll zeigen, wie sehr auf Details zu achten ist, will man jenseits allgemein gehaltener Maximen zu konkreten Mechanismen der Überlebens- und Fortpflanzungsspiele vordringen.
Aus seinen Befunden zieht Reichholf den Schluss, dass mit der sogenannten Handicap-Theorie der aufwendigen Ornamente nicht durchzukommen ist. Wären sie wirklich ein Signal dafür, dass die mit ihnen geschmückten Männchen sogar diesen eigentlich nachteiligen Aufwand verkraften und also genetische Pfundskerle sind, sollten mehr Männchen als Weibchen auf der Strecke bleiben. Aber Reichholfs Bilanzierungen weisen gerade in die andere Richtung: Die Weibchen scheinen in der Regel wegen ihrer unumgehbar hohen Investitionen in den Nachwuchs viel eher gefährdet; während sich der vieldiskutierte Pfauenschwanz und andere in unseren Augen auffällig wirkende Ornamente sogar als durchaus überlebensdienlich erweisen können. Sei es, weil die Fressfeinde auf Farben anders ansprechen oder wie im Fall des Pfauen zusätzlich die Körperkontur verunklärt wird. Womit die Schmuckformen übrigens auch den leicht tragischen Nimbus verlieren, den ihnen Darwin zu verleihen wusste, als er vom großen Maß der Leiden schrieb, aus dem ihre Schönheit hervorginge.
Kein gefährlicher Luxus steckt also dahinter, so Reichholf, wohl aber die Ausscheidung von Überschüssen an Proteinen und Energie, sofern die ökologische Gesamtsituation solche überhaupt ermöglicht: Überschüsse nämlich für die Männchen im Vergleich zu den Weibchen, die ja unmittelbar mehr in den Nachwuchs investieren müssen. Das Muster, das sich für Reichholf abzeichnet, läuft darauf hinaus, dass die Männchen solchen relativen geschlechtlichen Surplus aus überlebensdienlichen Gründen - vor allem Vermeidung von zu viel Körpermasse - durch die Ausbildung ihrer Ornamente und spektakuläre Balzveranstaltungen loswerden. Wozu die Beobachtung passt, dass diese Ornamente bei den betrachteten Arten dann auftreten, wenn die Männchen im Aufzuchtgeschäft eine bescheidene oder gar keine Rolle spielen.
Damit liegt Reichholf auf der Linie, die fehlerlose Ornamentierung unter die "ehrlichen Signale" zu reihen, an denen die Weibchen die Dienlichkeit der Männchen für die Nachwuchssicherung einschätzen können. Aber er stellt dabei ihre nachdrückliche, also auch energieaufwendige Präsentation vor die Feinheiten ihrer Ausbildung, weil er Letztere eher der erfolgreichen Artabgrenzung zuordnet als in ihnen vor allem den Angriffspunkt eines von den Weibchen ausgehenden Selektionsdrucks auszumachen.
Über diese Einordnung der sexuellen Evolution werden Biologen vermutlich ausgiebig streiten können. Aber Reichholf gelingt es mit seiner Darlegung jedenfalls vorzüglich, eine Vorstellung von den intrikaten Geflechten der Wirkungszusammenhänge zu geben, mit denen man es dabei zu tun bekommt. Die vorschnelle Erwartung, Adaptationen und ökologische Nischen einfach ausmachen zu können, zerfällt da rasch. Reichholf weist insbesondere auf die Spielräume hin, die sich zwischen der Körperorganisation und dem äußeren Erscheinungsbild auftun. Wer glaubt, Letzteres als Anpassung an welchen Selektionsdruck auch immer verstehen zu müssen, könnte demnach schon in eine Falle getappt sein. Was im gegebenen Fall direkte Anpassung ist, was nicht, wie Selektionsspielräume überhaupt aussehen - fast immer sind das schwierige und nur näherungsweise aufzudröselnde Fragen.
Gilt das bereits fürs Tierreich, wird die Sache natürlich nicht leichter, wenn man den Spuren der biologischen Vorprägungen in unseren eigenen, also kulturell durchgeformten Wahrnehmungsweisen von attraktiven menschlichen Körpern und Gesichtern nachspürt. Reichholf und seine für diesen Abschnitt beigezogene Mitautorin verfahren da auch eher vorsichtig. Dass ein Urteil über Körperschönheit mit Sexualität zu tun hat und einige dabei einfließende, eher basal ausfallende Eigenschaften vermutlich mit der Vorgeschichte "ehrlicher Signale" in Sachen reproduktiver Eignung zusammenhängen, wird man nicht als besonders überraschend empfinden. Eher kommt einem dabei in den Sinn, dass auf den Begriff der Schönheit eigentlich ganz gut zu verzichten wäre, solange es um die Anziehungskraft von Körpern geht: "Attraktivität" reichte hier vollauf und ließe gleich erkennen, dass die sexuelle Konnotation selbstverständlich ist.
Interessant wäre der Hinweis der Autoren, dass es keine "absolute", also von einer weitgehend biologischen Vorgeschichte abgekoppelte Wahrnehmung des Schönen gebe, doch eigentlich erst dann, wenn er für das ästhetische Empfinden abseits der Körperwahrnehmung angemeldet wird. Also etwa für den Reiz, den das Pfauenrad auf uns, nicht auf die Henne ausübt; oder auch der Schmetterlingsflügel, wie er auf dem Umschlag des Buchs zu sehen ist. Die Hinweise auf die fraglosen Reize der Symmetrie - doch reizvoll sind ja für uns auch oft ihre Störungen - sind da viel zu blass, brauchen vor allem kaum die Vorgeschichte der sexuellen Selektion.
Aber diesen Übertritt in die ästhetische Sphäre haben die beiden Autoren im Schlussabschnitt des Buches gar nicht vor Augen. Es geht ihnen dort vielmehr darum, plausibel zu machen, warum in unserem Fall die entschiedene Arbeit an der körperlichen Attraktivität nicht zuletzt auf die weibliche Seite wandern konnte und wieso als attraktiv empfundene Proportionen - etwa des Gesichts - sich in Menschenpopulationen nicht durchsetzen, sondern stattdessen eine breite Streuung individueller Ausprägungen den Ton angibt, die doch bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Man muss da wohl keine voreiligen Einreden befürchten: Es bleibt dabei, dass sich das Begehren eher in der Abweichung festsetzt. Was vielleicht auch der beste Grund ist, ideale Mittelwertsgesichter schlicht als schön zu bezeichnen - gerade weil sie den erotischen Funken kaum springen lassen.
Die Autoren sind meist vorsichtig genug, in keine biologischen Fundamentalismen zu verfallen, wissen auch dem Wettbewerb der phantasievollen Thesen zur Genese der naturgemäß interessierenden sekundären Geschlechtsmerkmale eher auszuweichen. Trotzdem kann man ihnen die Anmerkung nicht ersparen, dass Beobachtungen zu unserer gesellschaftlichen Realität, die mit der Wendung "biologisch gesehen" eingeleitet werden, vollkommen unabhängig von ihrer inhaltlichen Tendenz immer mit einem unhaltbaren Anspruch auftreten. Nicht, weil wir die Biologie losgeworden wären - dann würde wirklich gar nichts funktionieren -, sondern weil deren Verästelungen im kulturellen Regime sich nie einfach herauspräparieren lassen.
Hervorzuheben sind an der Darstellung denn auch weniger umwerfende Einsichten in die Realität von Körperdesign, Sex und Geschlechterrollen - eher stechen einige dabei unterlaufende Blauäugigkeiten hervor. Was einnimmt, ist vielmehr die bereits auf tatsächlich biologischem Terrain vorgeführte Schärfung des Blicks für die subtilen, gar nicht leicht anzugebenden Mechanismen des evolutionären Lebensspiels. Sagen wir es mit einem leicht abgewandelten Dichterwort: Das Schöne, es ist einer schrecklichen Kompliziertheit Anfang, erst recht "biologisch betrachtet".
Josef H. Reichholf: "Der Ursprung der Schönheit". Darwins größtes Dilemma.
Verlag C. H. Beck, München 2011. 304 S., Abb., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für den Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat der Autor ein Buch über die Freiheit geschrieben. Josef H. Reichholfs Auseinandersetzung mit Darwin zeugt laut Bredekamp von einer großen Portion Liebe des Autors für die Natur, die er anhand unmittelbarer Anschauung (etwa der Form und Funktion von Hirschgeweihen oder von Vogelfedern) als nicht bloß nützlich, sondern auch verschwenderisch schön und theatralisch kennenlernt. Dass Reichholf für seine groß angelegte evolutionsbiologische Untersuchung in den Wald geht, aber auch sprachmächtig fundamentale Fragen formuliert und kritischen Zeitbezug erkennen lässt, indem er etwa den Altruismus verteidigt, freut Bredekamp sichtlich. Die ein oder andere Auslassung oder Detailschwäche findet er angesichts einer solchen Fülle nützlicher Schönheit und ihres "anarchischen Spiels" verzeihlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH