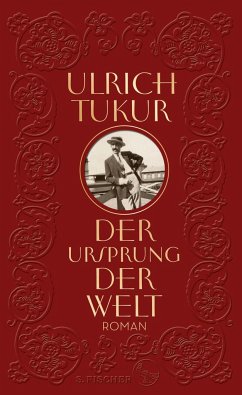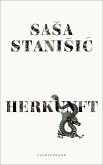Das ist nicht mehr die Welt von Paul Goullet: Er, der alte Bücher und Bilder liebt, die Schönheit, den Traum und die Phantasie, findet sich in einer Zeit, in der in Deutschland das Chaos herrscht. Um dem zu entkommen, reist er nach Paris, aber auch Frankreich hat sich in einen Überwachungsstaat verwandelt. Bei seinen Spaziergängen durch die Stadt stößt Goullet plötzlich auf etwas Unerhörtes: ein altes Photoalbum, dessen Bilder offenbar ihn selbst zeigen, inmitten eleganter Damen und Herren aus den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Fasziniert setzt er sich auf die Fährte seines Doppelgängers und folgt ihr nach Südfrankreich. Verstörende Visionen und Traumbilder beginnen ihn zu verfolgen, immer wieder scheint er die Zeit zu wechseln und sich in den Mann aus dem Photoalbum zu verwandeln. Und die Hinweise mehren sich, dass dieser ein furchtbares Geheimnis hat.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Verstiegener Plot, verblasener Stil: Ulrich Tukurs erster Roman sucht die finstere Vergangenheit in einer blassen Zukunft und scheitert fulminant.
Der Protagonist, zumindest eine seiner tauben Hälften, döst in dieses Buch hinein. Er erwacht in der ersten Zeile in Paris, vielleicht ist es aber auch nur der Beginn eines Traums, der in ein ganz anderes Leben führt. Pauls Blick, man darf sagen: Panther-Blick, wandert also in dem Pariser Hotelzimmer "ziellos und noch von Müdigkeit umschattet über die mit Stuck verzierte Zimmerdecke" und bleibt "an einem altertümlichen Messingleuchter" hängen: "Er betrachtete ihn einen Augenblick und fand ihn schön."
Da haben wir bereits das poetologische Programm dieses Schnörkelstuck-Romans in nuce. Sein Autor, der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur, findet altertümliches Erzählinventar offensichtlich einfach schön. Vermutlich rechnet er sich gemeinsam mit dem wenige Seiten später auftretenden "Bouquinisten" auch zu jenen "eigenwillig verrutschten Gestalten, die alte Bücher lieben, deren Zauber sich nur noch ihm und einigen wenigen Menschen erschließt".
Das ziellose Aufeinandertürmen abgestandener, gern gespreizt französisierter Bilder schon für hohe Literatur zu halten ist jedoch ein Missverständnis, das allenfalls in die Ödnis adjektivtrunkener Objekt- und Gefühlsbeschreibungsorgien führt: "Er aß ein frisches, noch warmes Baguette, das er mit gesalzener normannischer Butter bestrich"; oder: "Auf der anderen Seite des Zimmers standen ein dunkelgrün bezogenes Empiresofa und daneben eine Stehlampe, deren Schirm mit fernöstlichen Motiven dekoriert war"; oder: "Goullet verspürte in sich eine seltsame Bindungslosigkeit und offenkundige Unfähigkeit, aus allem, was er erlebte, ein klares, deutliches Gefühl zu beziehen"; oder: "Als er begriff, dass er sich nicht täuschte, überkam ihn ein namenloser Schrecken." Der Schrecken wird nicht namhafter dadurch, dass dieser angestaubte und teils ungelenke Atmo-Zierrat, der so gut wie nie eine tiefere Bedeutung aufweist, an eine überambitionierte Großvater-Handlung angeklebt wurde. Denn auch an diesem schiefen Plot schreit nichts danach, erzählt zu werden; er gefällt sich als L'art pour l'art.
Die Prämisse des Romans lautet, dass sich Geschichte wiederholen kann. So legt sich im Jahr 2033 erneut ein dunkler Schatten auf Europa: In Frankreich regiert eine Überwachungs-Militärdiktatur, während eine Aggressionsmacht, Russland diesmal, osteuropäische Staaten überrennt. Das aber wird nur oberflächlich angerissen und wirkt in Verbindung mit dem betulichen Tonfall (jenseits einiger Hologramme und Implantate ist hier einfach 1933) und einer flauen Technikkritik ("Roboter führen Befehle aus, sie brauchen keine Demokratie") leider komplett konstruiert, so ähnlich vielleicht, wie das Detail eines geheimen Tunnels, der an anderer Stelle schnell hinzuerfunden werden muss, weil sich der Erzähler in eine ausweglose Lage geplaudert hat. Der aus dem zusammengebrochenen Deutschland geflohene Paul Goullet stößt in dieser Nahzukunft auf ein Fotoalbum, das ihn selbst zu zeigen scheint, allerdings ein gutes Jahrhundert zuvor. Ihm ist schnell klar, dass das Mysterium mit seinem Großvater zu tun haben muss, dem gefürchteten Gestapochef von Toulouse, der nach dem Krieg in Stuttgart Karriere als Verwaltungsjurist machte. Paul begibt sich nun in Südfrankreich auf Selbstsuche. Dabei wird er in fast schon lachhafter Weise (man darf an expressionistische Filme denken) von lichtblitzartigen Erinnerungen an die im Jahr 1943 spielenden Ereignisse heimgesucht.
Bald ist deutlich, dass die frühere Variante des Protagonisten Prosper Genoux hieß und das Böse schlechthin verkörpert. Unter dem Vorwand, vom Vichy-Regime oder der Gestapo verfolgten Personen die Flucht nach Spanien zu ermöglichen, lebte Genoux finsterste Sexualmordphantasien aus. Ein weiteres Geheimnis, das mit einer Frau zu tun hat, stellt die Verbindung zu Pauls (Adoptiv-)Familie Goullet her. Der Held gerät wie sein Vorgänger in Partisanenkreise, trifft seine Traumfrau und muss über die Pyrenäen fliehen, alles in allzu auffälliger Spiegelung der Ereignisse neunzig Jahre zuvor, wenn auch in umgekehrter Gut-Böse-Wagenreihung.
Ob es sich aber um einen Roman über Schuld oder gar Erbschuld handelt, bleibt unklar, weil jede intellektuelle Rahmung fehlt. Die einzige Einsicht, zu der diese zwischen Biedermeier und magischem Realismus verstolperte Erzählung vom doppelten "P.G."chen führt, lautet schlicht, das Leben sei ein "Geflecht", das "alles Böse und Gute, Tote und Lebendige miteinander verband". Das ist dünn, äußerst dünn.
Traumerklärungen für ein zuvor wortreich ausgemaltes Mysterium sind immer enttäuschend, hier aber in potenzierter Weise, denn der Protagonist muss immer wieder erstarren, damit das Binnentrauma (als Traum) fortgeführt werden kann. Trotzdem erklärt der Erzähler uns und seinem begriffsstutzigen Helden mit onkelhafter Ausdauer jedes einzelne Hinüberdämmern: "Zum zweiten Mal hatte er die Besinnung verloren und dabei etwas berührt, das kein Traum war, sondern die Wirklichkeit einer anderen Dimension"; "vielleicht spielte das Schicksal mit ihm"; "manchmal denke ich, es ist ein und dasselbe, als verliefe die Zeit nicht linear, sondern alles, Vergangenheit und Gegenwart, spielte sich gleichzeitig ab". Diese narrative Dauerlegitimation nervt beinahe noch mehr als der wenig originelle (und inhaltlich überdies sinnlose) Einfall der Doppelidentität selbst.
Als Drehbuchentwurf ginge das vielleicht durch, zumal zur kriminalistisch-genealogischen Ebene (was geschah mit Oma?) und zu den reißerischen Episoden (gemarterte Frauen; verfolgte Männer) noch einige Letzte-Worte-Sterbeszenen und ein opulent inszeniertes Finale im Kinostil hinzukommen. Doch weil sich der Autor nicht mit einem Filmskript begnügt hat, stehen wir nun vor einer Ruine von Roman, der kaum mehr ist als grelle Literatur-Mimikry ohne allzu viel Sinn für die künstlerische, also sprachlich-stilistische Durchdringung seines Stoffs, für die Überhöhung des Geschehens durch eine historisch-moralische Reflexion oder auch nur für die psychologische Dimension des Erzählten. Sich an Fin-de-Siècle-Romanen zu bedienen oder eine Straße nach Victor Hugo zu benennen, reicht nicht.
Die Figuren bleiben papieren und zeigen keinerlei Entwicklung. Das Geschlechterbild ist stumpf: Paul wird durch eine Frau vom dunklen Trieb der gewaltsamen Frauenverachtung geheilt, den er offenbar von seinem Alter Ego ererbt hat. Wen soll das interessieren? Und wo hingegen sind all die Opfer des an SS-Sturmbannführer Rudolf Bilfinger angelehnten Gestapo-Chefs von Toulouse? Sie kommen nicht vor. Die sensationslüsterne Handlung überzeugt damit weder als Zukunftsdystopie noch als historischer Zeitroman oder als politischer Einspruch. Manche Rückblenden schrammen sogar am stiefelknallenden Nazi-Kitsch vorbei, wenn etwa der schick schwarzuniformierte Gestapo-Opa den Kunstkenner gibt - alle haben einen Spleen in Bezug auf Courbets Skandalgemälde "Der Ursprung der Welt": harte Männer und ihr Mutter-Trauma -, um dann die Peitsche durch Gesichter zu ziehen.
Literarisch herrscht hier, um es altbacken dekadent zu sagen, "eine Art erregter Stillstand oder erzwungener Müßiggang, als wäre die Zeit stehengeblieben und es gäbe keine Richtung mehr, in die man sich bewegen könnte". Es gibt Schlimmeres als ein Debütroman, in dem Antlitze bei jedem Schrecken "aschfahl" werden, aber mit der Erkundung des Nullpunkts der deutschen Seele ausgerechnet ein Sujet gewählt zu haben, das derart oft höchst virtuos verarbeitet wurde, ist schon ungeschickt. Sorgte der Promistatus des Verfassers dafür, dass diese selbstgefällige Tändelei dem Verlag als Spitzentitel gilt? Einen Gefallen tut man damit niemandem.
OLIVER JUNGEN.
Ulrich Tukur: "Der Ursprung der Welt". Roman.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019. 304 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ungeheuer spannend [...]. Wie schon in seinen Erzählungen und der Novelle mischt Tukur furios Zeit- und Realitätsebenen. [...] ein Meister darin, das Dunkle leicht zu präsentieren. Katja Weise Norddeutscher Rundfunk. NDR Kultur 20191009