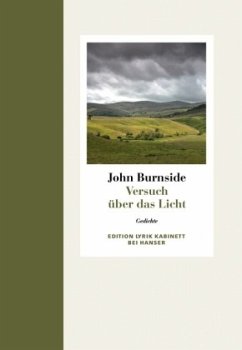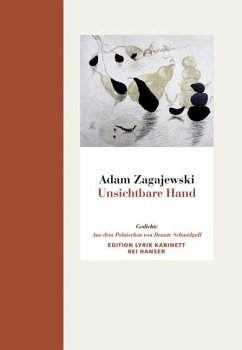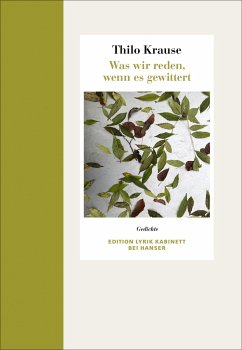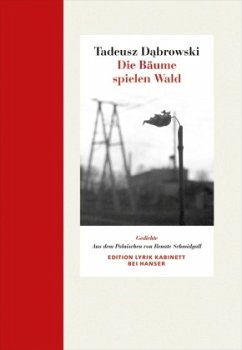Der verlorene Sohn
Engl.-Dtsch.
Mitarbeit: Göske, Daniel;Übersetzung: Göske, Daniel
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mit einer herbstlichen Zugfahrt beginnt Derek Walcott sein großes Spätwerk. Der Augenblick der Leere, des Wartens, löst eine innere Reise aus, die durch weite geografische und geistige Landschaften führt: von Greenwich Village bis zu den Alpen, von Italien bis nach Deutschland. Doch hinter allem steht das Bild von Walcotts Heimatort St. Lucia und der lebendigen See. Derek Walcott hat ein großes Epos geschaffen, das ausgespannt ist zwischen einem erschöpften Europa und der neuen Welt, zu der der Wanderer zurückkehren muss, um seine eigene poetische Existenz wiederzufinden.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.