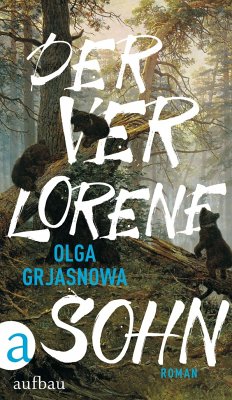»So sinnlich und anschaulich wie Olga Grjasnowa schreiben auf Deutsch nur wenige.« DER SPIEGEL. Akhulgo, Nordkaukasus, 1839: Jamalludin wächst als Sohn eines mächtigen Imams auf. Seit Jahrzehnten tobt der Kaukasische Krieg, und sein Vater wird von der russischen Armee immer mehr bedrängt. Schließlich muss er seinen Sohn als Geisel geben, um die Verhandlungen mit dem Feind aufzunehmen, und Jamalludin wird an den Hof des Zaren nach St. Petersburg gebracht. Bald schon ist der Junge hin - und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach seiner Familie und den verlockenden Möglich keiten, die sich ihm in der prächtigen Welt des Zaren bieten. Olga Grjasnowa erzählt sprachmächtig von einem Kind, das zwischen zwei Kulturen und zwei Religionen steht und seine Identität finden muss. Und von der verheerenden Wirkung eines Krieges, in dem es keine Sieger geben kann. »Olga Grjasnowa ist eine vielbeachtete Stimme ihrer Generation.« NDR
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Für diesen Roman hat sich Olga Grjasnowa an einer historischen Begebenheit inspiriert, erklärt Rezensentin Katharina Granzin: Der Scheich der muslimischen Bergvölker Dagestans gab seinen russischen Gegnern 1839 seinen eigenen neunjährigen Sohn als Verhandlungspfand zur Geisel, der infolgedessen in Petersburg im Einflussbereich der Zarenfamilie aufwuchs. Laut Granzin gelingt es der Autorin, die psychologische Entwicklung des Sohns zugleich glaubhaft und doch nicht zu detailreich zu schildern. Außerdem bewundert sie Grjasnowas Mut, die Geschichte sehr frei auszuschmücken. Der Lohn: das Bild einer fremden Epoche "in klaren, frischen Farben".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Olga Grjasnowas "Der verlorene Sohn" nutzt einen Topos der europäischen Literaturgeschichte für ein Romanexperiment: Wie erzählt man einen Stoff des neunzehnten Jahrhunderts im einundzwanzigsten?
Von Tilman Spreckelsen
Sein Vater liefert ihn als Geisel dem russischen Feind aus, seine Mutter versichert dem Neunjährigen: "In ein paar Tagen bist du wieder bei mir", und als Jamalludin an diesem Augusttag 1839 tatsächlich im Lager der Gegner ankommt, ahnt er nicht, dass aus den paar Tagen mehr als fünfzehn Jahre werden sollen. Denn Zar Nikolai, der auf die Auslieferung des ältesten Sohnes seines Widersachers, des awarischen Fürsten Schamil, als Vorbedingung zu Friedensverhandlungen bestanden hatte, kassiert den Knaben und lässt ihn über einige Umwege nach Petersburg bringen, während er das Reich von dessen Vater im heutigen Dagestan weiter mit Krieg überzieht.
Jamalludin, der anfangs kein Wort Russisch spricht, wird auf eine Kadettenanstalt gesteckt. Er erweist sich als intelligenter Schüler, tut sich allerdings schwer mit der Disziplin, die man von ihm verlangt. Der Zar selbst nimmt Anteil an seinem Werdegang und zeichnet ihn bei jeder Begegnung aus. Dass er sich fremd fühlt und von Lehrern oder Mitschülern wegen seiner Fremdheit argwöhnisch beäugt wird, ändert sich durch diese Gunstbeweise nicht. Er selbst beharrt auf dieser Rolle, klammert sich an die Erinnerungen, die ihm von seiner Heimat bleiben und die dennoch immer unklarer werden, an die awarische Sprache, die ihm entgleitet, an den Islam. Und als er seinen ebenfalls nach Petersburg entführten Vetter Gamzat trifft, der sich längst in der russischen Kultur aufgehoben fühlt, stehen die beiden Jungen kurz vor einer Prügelei.
Doch Jamalludin verliebt sich ("Clara war das Leben selbst"), verliebt sich ein weiteres Mal (Lisa "glich einem Schmetterling, unbeschwert und frei"), will sich verheiraten und steht vor einer Karriere in der russischen Armee, als sein Vater den mittlerweile 24 Jahre alten Offizier nun doch freipressen kann. Für Jamalludin ist das ein Schock, schließlich ist er sich über seine kulturelle Identität alles andere als klar. Zurückgekehrt ins religiös recht strikte Reich seines Vaters, des Imams, wird er von Beginn an als Verräter angesehen, gar als "Monster", wie ihm bei einer Rundreise klarwird. Seine Kenntnisse der russischen Armee und Verwaltung sind zwar nützlich, lassen den Argwohn der anderen aber nicht kleiner werden. Nützlich im Krieg ist er nicht, und der Frieden, den er herbeiführen möchte, ist unter den Gotteskriegern verpönt.
Mit ihrem Roman "Der verlorene Sohn" greift die 1984 im aserbaidschanischen Baku geborene Olga Grjasnowa, die in Berlin lebt und auf Deutsch schreibt, ein Modethema des neunzehnten Jahrhunderts auf: die jahrzehntelangen erbitterten Kämpfe des awarischen Imams Schamil gegen die russischen Invasoren im Kaukasus. Bereits um 1850 kursierten in Westeuropa kolorierte Stiche, die "Schamyl den Schreckbaren, Held und Prophet im Kaukasus" zeigten. Sein Kampf gegen den Zaren fand damals Eingang in Enzyklopädien, ihm wurden Sachbücher und Romane gewidmet ("Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen die Russen", "Prinz Schamyls Brautwerbung" und vieles mehr), Sammelbilder von Liebigs Fleischextrakt zeigten seine endgültige Niederlage im Jahr 1859, der georgische Autor Grigol Robakidse griff eine Episode für seine "Kaukasischen Novellen" auf, und bis in die jüngere Zeit ist sein Schicksal Thema in Jugendbüchern. Unter all diesen Adaptionen ragt Leo Tolstois erst postum veröffentlichter Roman "Hadschi Murat" heraus, der dem awarischen Kampf gegen die Russen ein Denkmal setzt, und in Rassul Gamsatows Roman "Mein Dagestan" von 1972 erzählt der Autor ausführlich von dem Imam, aber auch vom Verlust seines Sohnes an die Russen und davon, was auf die Rückkehr des bei Gamsatow "Dshamalutdin" genannten jungen Mannes folgt: die Entfremdung von der Heimat, das Unverständnis zwischen Vater und Sohn, der sich beiden Kulturen angehörig fühlt. "Zwei Adler lebten in Dshamalutdins Brust. Sie zerrissen sein Inneres."
Dieser Disposition gilt das Interesse Grjasnowas, und auch wenn die Perspektive des entwurzelten jungen Mannes nicht konsequent durchgehalten, sondern mit vielen erklärenden Beobachtungen jenseits dieses Horizonts begleitet wird, konzentriert sie sich auf Jamalludins Geschichte, auf sein Aufwachsen ohne Eltern in der Fremde und auf die Frage, woran sich jemand festhält, der in dieser Situation nicht einmal Briefe oder wenigstens Nachrichten von der Familie erhält. Eine wichtige Rolle spielen Sprachen, ihr Erwerb und ihr Verlust, spielen Freundschaften und Momente des gesellschaftlichen Aufstiegs. Aber auch das Misstrauen gegenüber der neuen Umgebung wird eingefangen, die ewige Wachsamkeit, ob nicht wieder jemand heimlich oder offen den Fremden abschätzig betrachtet.
Zugleich bemüht sich Grjasnowa darum, Jamalludins Schicksal in die Historie einzubetten, den Glanz des Zarenhofs zu schildern und das wachsam beobachtete Elend der anderen. Von fern wetterleuchten Dumas, Tolstoi, Dostojewskij oder die Sängerin Henriette Sontag, was mal organisch und dann wieder herbeigezwungen wirkt. Auch Puschkin erscheint unter diesen Verweisen, mit ihm allerdings wesentlich konkreter die Familie Olenin - der Dichter war einst in eine Anna Olenina verliebt gewesen, deren Neffe bei Grjasnowa nun zu Jamalludins Freund avanciert und dessen Schwester Lisa wiederum zur Verlobten des jungen Mannes.
Die Erzählerin zeigt dabei keine Scheu vor Floskeln, und leise Töne sind ihre Sache nicht. Da sind "die endlosen Ebenen Russlands" oder "die unendlichen Weiten der russischen Landschaft" und dergleichen mehr, der "hochsommerliche Nachmittag floss dahin wie Honig", und der verliebte Jamalludin kreist um Lisa "wie die Motte um das Licht". Erzählt wird gern in Gegensätzen, was die Dinge klarer erscheinen lässt, als sie vielleicht sind, Figuren werden eingeführt und wieder fallengelassen, und doch hält die Frage nach Identität und Zugehörigkeit, die sich etliche Protagonisten aus nachvollziehbaren Gründen stellen, das bunte Figurenensemble um Jamalludin so weit zusammen, dass man der Handlung folgt.
Dass der Stoff dazu taugt, ihn historisch zu betrachten und auf die Gegenwart zu beziehen, steht außer Frage. Deshalb liest man den Roman mit Gewinn. Warum sprachlich so ausgetretene Pfade gewählt werden, erschließt sich dagegen nicht. Erst auf den letzten Seiten zeigt die Autorin, dass sie auch anders kann, dass sie, im Stil plötzlich nüchtern und zugleich innovativ, eine Wirkung erzeugen kann, die man zuvor vermisste.
Olga Grjasnowa: "Der verlorene Sohn". Roman.
Aufbau Verlag, Berlin 2020. 383 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein fein ausgearbeiteter historischer Roman, der sich mit Verlorenheit und Zugehörigkeit beschäftigt - zwei Themen, die auch heute noch zu den Wichtigsten unserer Zeit gehören.« Sally-Charell Delin SR 2 Kulturradio 20201216