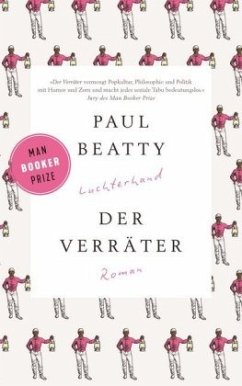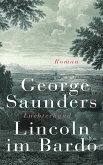Eine bissige, kühne Satire über eine Gesellschaft, die ihre ethnische Spaltung noch lange nicht hinter sich gelassen hat.
Dickens, ein Vorort von Los Angeles, ist der Schandfleck der amerikanischen Westküste: verarmt, verroht, verloren. Zugleich ist es der ganze Stolz seiner schwarzen Einwohner, eine Bastion gegen die weiße Vorherrschaft. Hier zieht der Erzähler von "Der Verräter" friedlich Wassermelonen und Marihuana. Doch als sein bürgerrechtsbewegter Vater durch Polizeigewalt stirbt und die Gentrifizierung den gesamten Vorort auszuradieren droht, wird er unversehens zum Anführer einer neuen Bewegung: Mit seinem Kompagnon Hominy, alternder Leinwandheld aus "Die kleinen Strolche", führt er Sklaverei und Rassentrennung wieder ein ...
Dickens, ein Vorort von Los Angeles, ist der Schandfleck der amerikanischen Westküste: verarmt, verroht, verloren. Zugleich ist es der ganze Stolz seiner schwarzen Einwohner, eine Bastion gegen die weiße Vorherrschaft. Hier zieht der Erzähler von "Der Verräter" friedlich Wassermelonen und Marihuana. Doch als sein bürgerrechtsbewegter Vater durch Polizeigewalt stirbt und die Gentrifizierung den gesamten Vorort auszuradieren droht, wird er unversehens zum Anführer einer neuen Bewegung: Mit seinem Kompagnon Hominy, alternder Leinwandheld aus "Die kleinen Strolche", führt er Sklaverei und Rassentrennung wieder ein ...

© BÜCHERmagazin, Sonja Hartl (sh)

Eine verrückte Suada mit der Wut von Allen Ginsbergs "Howl" und dem Witz tagesaktueller Stand-up-Comedy: In Paul Beattys Satire "Der Verräter" will ein schwarzer Erzähler die Sklaverei wieder einführen, um Amerika aufzurütteln.
Von Jan Wiele
Dass dieses Buch auf Englisch mit einem aufgedruckten Lob der Komikerin Sarah Silverman erschien, ist eine erste Vorbereitung auf seinen zersetzenden Humor; aber selbst wenn man alle unkorrekten Witze aller berüchtigten amerikanischen Comedians zusammennimmt, wird man nicht annähernd die Dichte erreichen, die Paul Beattys Roman "Der Verräter" aufbietet. "Aus dem Mund eines Schwarzen klingt das sicher unglaublich, aber ich habe nie geklaut", lautet sein erster Satz. Es ist bei weitem noch nicht sein provokantester. Wenn man so will, ist das Buch eine Dauerprovokation, allerdings im Gegensatz zu mancher Stand-up-Comedy keine schnell verpuffende, sondern eine lang nachwirkende. Das weiß man bereits nach den ersten 33 Seiten des Prologs, der für sich in die Literaturgeschichte eingehen könnte und mit den Worten endet: "Die Lynch-Party kann beginnen!"
Der in diesem Roman spricht, ist massiv traumatisiert und steht zudem nach eigener Auskunft unter Drogen. Als wir diesem sonderbaren Erzähler zuzuhören beginnen, sitzt er im Supreme Court der Vereinigten Staaten und wartet auf seinen Prozesstermin. Der Grund: Er hat versucht, Rassentrennung und Sklaverei wieder einzuführen - wohlgemerkt, um zu zeigen, dass beide ohnehin noch existieren, selbst wenn sie nicht mehr offen so bezeichnet werden. Der große Reiz an Beattys Erzählung liegt darin, dass sie diese Unglaublichkeit, diese satirische Überspitzung, einbettet in realistische, teils historische Ereignisse. Beatty baut immer wieder anhand real existierender oder leicht fiktionalisierter Orte, Namen und Geschehnisse fundierte Settings auf, die dann durch groteske Einfälle plötzlich in die Luft gejagt werden.
Der Ort des Geschehens liegt im Großraum Los Angeles und heißt in der Fiktion Dickens. Die reale Vorlage dafür ist Compton, Wiege des Gangsta-Rap, suburbane Niedergangsgegend. Wegen dieses Niedergangs ist Dickens von den Karten getilgt worden, es gibt stattdessen gentrifizierte Teilbezirke mit ganz neuen Namen, in denen man so tut, als ob der Rest nicht existierte. Tatsächlich aber lebt in jenem Rest der Erzähler, er ist sogar dort aufgewachsen und verfolgt mit seinem Plan, segregierte Schulen wieder einzuführen und Sitzplätze nur für Weiße im Bus, nichts anderes als die dramatische Erzeugung von Aufmerksamkeit für das vernachlässigte Viertel.
Warum der Erzähler zu solchen Mitteln greift, wird bei der Schilderung seiner Kindheit verständlicher: Von seinem Vater, einem Sozialwissenschaftler, wurde er zu Experimenten in Verhaltenspsychologie missbraucht, die sich um schwarze Identität und den Umgang mit Rassismus in Amerika drehten. So grausam der Vater hier wirkt, so anders wird er sonst wahrgenommen: Im Viertel ist der Mann, der nebenbei Farmer ist und Pferde hält, auch als "Nigger-Whisperer" bekannt, weil er Schwarze in Not, die etwa vor einem Amoklauf oder vor dem Suizid stehen, durch gutes Zureden davon abbringt: Kaum legt er seinen "Tweedsakko-Arm" um einen von ihnen und flüstert ihm eine tiefe Wahrheit ins Ohr, übergibt noch der schwerste Junge "brav die Waffe und den Schlüssel zu seinem Herzen". Diese märchenhafte Deeskalationsfigur hat sich Beatty indes wohl nur ausgedacht, um sie sodann desto härter mit einer gegenwärtigen amerikanischen Realität kollidieren zu lassen: Als der Vater auch eine Auseinandersetzung mit Polizisten durch schlaue Worte lösen will, wird er von diesen ohne Umschweife hinterrücks erschossen - so, wie es in den vergangenen Jahren in den Vereinigten Staaten wirklich vorgekommen ist.
In der Schilderung der furchtbaren Polizeigewalt entfaltet Beattys Satire maximale Schärfe. Spätestens danach zeigt der erzählende Sohn Anzeichen von Realitätsverlust und Irrsinn; er fasst allerdings auch den Plan, irgendwie doch in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Alles Weitere, was er unternimmt, ist Teil einer halb ernsten, halb ridikülisierten Suche nach schwarzer Identität. Dazu gehören auch seine grotesken Segregationsund Sklavenhaltungsideen, die Züge einer Kunstaktion haben, außerdem eine gewisse Verwandtschaft mit Filmen von Spike Lee oder Quentin Tarantino. Ihren verstörenden Höhepunkt wird diese Aktion erreichen, wenn er auf offener Straße einen alten schwarzen Mann mit dem Gürtel auspeitscht, der das auch noch selbst so will. Dieser Hominy Jenkins ist ein von Beatty erfundener ehemaliger Kinderstar aus dem Kreis der "Kleinen Strolche", der in seinem Leben so viel Rassismus erfahren hat, dass er am Ende so weit ist, seine empfundene Sklavenrolle auch aller Welt zeigen zu wollen.
Was Beattys Roman zu einer so herausfordernden Lektüre macht, ist sein ständiges Schwanken zwischen solchen Verrücktheiten und den beschriebenen Realitätseffekten. Es gibt daher keine durchgängige Rezeptionshaltung, sie pendelt vielmehr zwischen Schmunzeln und Schock - wobei freilich auch viele einfach nur witzige Exkurse in dem Werk stecken, etwa ein kurzes Zwischenspiel, in dem es um die Suche einer Partnerstadt für Dickens geht. Zur Debatte stehen Ciudad Juárez, Tschernobyl und Kinshasa. In der mexikanischen "Stadt, die nie aufhört zu bluten", findet man Dickens allerdings "zu brutal". Tschernobyl sagt ab, weil die Umweltverschmutzung um Los Angeles zu groß sei, und für Kinshasa ist Dickens schlicht "zu schwarz".
An solchen Stellen schimmert durch, dass Beatty vom Poetry-Slam herkommt und daher oft gezielt auf Pointen hinsteuert. Er war aber auch Lyriker, was den etwas überkandidelten Metaphern- und Vergleichszwang des Erzählers erklärt, der aus den Tiefen der amerikanischen Kultur- und Entertainmentgeschichte schöpft und manchmal äußerst voraussetzungsreich ist. Das alles auf Deutsch wiederzugeben ist oft überaus schwierig und hat eine immense Leistung von Henning Ahrens verlangt. Ohne den Übersetzer kritisieren zu wollen, darf man vielleicht sagen, dass eine derartige lyrische Suada - Beatty hat auch bei Allen Ginsberg gelernt und verdankt dessen Amerika anklagendem Prosapoem "Howl" einiges - stellenweise nur im Original die richtige Wirkung entfaltet. Andererseits ist dieses Original wirklich nicht leicht zu lesen; umso dankbarer ist man für die Übersetzung.
Für den Tonfall hat Beatty, wenn man so will, schon lange geübt und mit "Der Sklavenmessias" (1999) oder "Slumberland" (2009) auch schon ein ganz ähnliches Satirekonzept verfolgt - mit dem "Verräter" hat er es allerdings auf die Spitze getrieben und ist dafür 2016 mit dem Booker-Preis belohnt worden. Am Ende des Romans muss der Oberste Gerichtshof darüber entscheiden, "ob ein Verstoß gegen die Bürgerrechtsgesetze, der das verwirklicht hat, was diese Rechte ursprünglich leisten sollten, aber nicht geleistet haben, eine Verletzung ebendieser Rechte darstellt". Diese Fragestellung kann man ganz gut auf den Roman übertragen: Für viele mag er in seiner satirischen Radikalität durchaus eine Verletzung bedeuten - aber wird diese womöglich aufgewogen durch einen kathartischen Effekt?
Paul Beatty: "Der Verräter". Roman.
Aus dem Englischen von Henning Ahrens. Luchterhand Verlag, München 2018. 352 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Mit 'Der Verräter' hat Beatty nicht nur einen anmaßenden, überdrehten, unerschrockenen Roman geschrieben. Sondern einen Weckruf.« Dennis Pohl / SPIEGEL ONLINE